Einleitung
Vermutlich hatte jeder schon mal dieses Erlebnis: Man prüft vermeintlich, ob man alles hat, wirft einen Blick auf die (digitale) Uhr und verlässt morgens die eigenen vier Hände. Erst nach dem Tür ins Schloss gefallen ist, oder später noch, merkt man, dass die Kopfhörer noch auf dem Schreibtisch liegen, man den falschen Schlüssel eingesteckt hat, oder das Ladekabel des Laptops liegen lassen hat. Manchmal will man eigentlich eine wichtige E-Mail schreiben, wird aber von einer anderen Aufgabe abgelenkt – und erinnert sich erst Stunden später wieder daran.
Für Menschen mit ADHS sind solche Situationen nicht die Ausnahme, sondern häufig der Alltag. Es ist keine „Faulheit“ oder „Unaufmerksamkeit“, die ursächlich hierfür ist, sondern um Schwierigkeiten in den sogenannten exekutiven Funktionen („EF“) – also jenen mentalen Prozessen, die helfen, Informationen zu speichern, zu priorisieren und gezielt abzurufen (Barkley, 2015). Eben dieses chronische Muster von Gedächtnislücken und Organisationsproblemen ein Kernmerkmal von ADHS ist und nicht mit gelegentlicher Nachlässigkeit verwechselt werden darf (Huss, 2018; Retz und Rösler, 2009). Nach Döpfner (2017) haben Betroffene häufig Schwierigkeiten, Handlungspläne konsistent umzusetzen und Routinen aufrechtzuerhalten, was wiederum zu wiederkehrender Vergesslichkeit führt. Krause und Krause (2014) heben zudem hervor, dass diese Herausforderungen ein lebenslanger Begleiter sind, von der Kindheit an bis ins Erwachsenenalter hinein. Dieses Wissen hierum ermöglicht einen Perspektivenwechsel: Statt sich selbst für das Vergessen zu kritisieren, kann man lernen Strukturen aufzubauen, die Stärken fördern und Schwächen abfedern und daraus resultierenden Herausforderungen im Uni- oder Berufsalltag vermeiden.
Wie in anderen Blogposts erwähnt, gibt es genug Strategien und Hilfsmittel, die dabei unterstützen können, den Überblick zu behalten und das eigene Gedächtnis zu stärken. Nicht nur die Hilfsmittel und Routinen sind dabei von Vorteil, sondern auch strukturierte Umgebungen und die bewusste Gestaltung von Erinnerungshilfen, die kognitiven Belastungen deutlich reduzieren können (Barkley, 2020; Kofler et al., 2018).
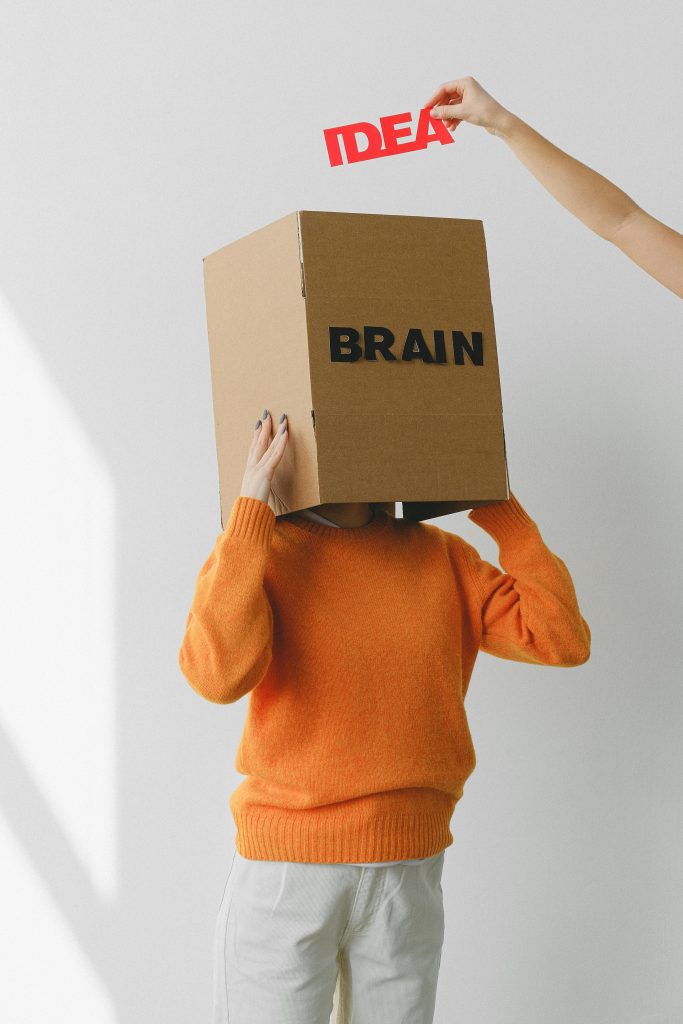
Nachfolgend sollen zuerst aber die Unterschiede und Ursachen der Vergesslichkeit in Abgrenzung zu ADHS herausgestellt werden, sowie die Beeinflussungen im Alltag. Im Anschluss sollen Ansätze vorgestellt werden, die dabei helfen, ebene jene Zustände zu vermeiden und zu einem strukturierteren Alltag zu gelangen.
Wie sich „normales“ Vergessen äußern kann
Wie eingangs erwähnt, kann es immer mal vorkommen, dass etwas liegen gelassen oder vergessen wird, selbst wenn man es einige Sekunden zuvor noch im Kopf hatte. In den meisten Fällen ist Vergesslichkeit kein Hinweis auf eine tiefgreifende Störung, sondern Ausdruck situativer Belastungen. Stress, Schlafmangel und anhaltende Ablenkung durch Multitasking schränken die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ein und verhindern eine stabile Konsolidierung von Informationen (Killgore, 2010; Baddeley, 2012). Auch fehlende Motivation oder emotionale Relevanz spielen eine Rolle: Inhalte, die nicht bedeutsam erscheinen, werden weniger zuverlässig gespeichert. In solchen Situationen äußert sich Vergesslichkeit typischerweise in Form des Verlegens von Gegenständen, dem kurzzeitigen Entfallen von Namen oder Terminen oder leichten Konzentrationslücken. Entscheidend ist, dass diese Phänomene unregelmäßig auftreten, sich nach Erholung oder Stressabbau zurückbilden und die Alltags- und Arbeitsfähigkeit insgesamt nicht wesentlich beeinträchtigen (Kirova, Bays & Lagalwar, 2015). Damit unterscheidet sich „normale Schusseligkeit“ deutlich von der persistierenden, exekutiv verankerten Vergesslichkeit bei ADHS, die unabhängig von situativen Faktoren besteht und in allen Lebensbereichen zu funktionellen Einschränkungen führt.
Vergesslichkeit im Alltag ist ein universelles Phänomen, das keineswegs zwangsläufig auf eine klinische Störung wie ADHS hinweist. Häufig entstehen Gedächtnislücken durch alltägliche Belastungsfaktoren wie Stress, Überlastung oder Müdigkeit, die das Arbeitsgedächtnis temporär überfordern und die effiziente Informationsverarbeitung verhindern. Auch Schlafmangel spielt eine zentrale Rolle, da er die neuronale Konsolidierung im Hippocampus beeinträchtigt und somit das Behalten neu gelernter Inhalte erschwert (Killgore, 2010). Hinzu kommt die zunehmende Zerstreuung moderner Arbeitswelten: Multitasking und ständige Unterbrechungen reduzieren die Tiefe der Enkodierung, sodass Informationen nicht dauerhaft gespeichert werden (Baddeley, 2012). Viele Apps sind so gestaltet, dass sie möglichst einfach die Aufmerksamkeit gewinnen und so lange wie möglich halten. Immer spektakulärere Dopaminfeuerwerke sollen hierfür gezündet werden, die wiederum dazu führen, dass das Bewusstsein für die Norm sich verschiebt. Praktisch heißt das, dass fehlende Motivation oder geringe persönliche Relevanz dafür sorgen, dass Inhalte gar nicht erst mit ausreichender Intensität ins Gedächtnis überführt werden, sondern kurze Zeit später bereits ad acta gelegt werden. Altersbedingte Veränderungen wie eine verlangsamte Informationsverarbeitung oder leichte Einbußen im episodischen Gedächtnis sind ebenso normale Erscheinungen, die jedoch klar vom pathologischen Vergessen abzugrenzen sind (Kirova, Bays & Lagalwar, 2015).
Symptomatisch zeigt sich diese Form der Vergesslichkeit in typischen Alltagssituationen: Schlüssel oder Handy werden verlegt, Termine geraten in Vergessenheit oder Namen fallen im entscheidenden Moment nicht ein. Entscheidend ist jedoch, dass diese Lücken unregelmäßig und kontextabhängig auftreten, meist verstärkt in Phasen erhöhter Belastung, und dass die allgemeine Funktionsfähigkeit im Berufs- und Privatleben weitgehend erhalten bleibt. Die Beobachtung dieser Kontextfaktoren wie Dauer, Häufigkeit und Begleitumstände erlauben bereits eine erste differenziertere Betrachtung (McDaniel & Einstein, 2007). Anders als bei ADHS handelt es sich nicht um eine chronische und pervasive Beeinträchtigung exekutiver Funktionen, sondern um vorübergehende und unregelmäßig auftretende Schwankungen der kognitiven Leistungsfähigkeit. Sobald es zu einer Erholung oder Stressabbau kommt, bilden sich diese zurück und die Alltags- und Arbeitsfähigkeit werden insgesamt nicht wesentlich beeinträchtigt (Kirova, Bays & Lagalwar, 2015). Damit unterscheidet sich „normale Schusseligkeit“ deutlich von der persistierenden, exekutiv verankerten Vergesslichkeit bei ADHS, die unabhängig von situativen Faktoren besteht und in allen Lebensbereichen zu funktionellen Einschränkungen führt.
Warum das Gehirn bei ADHS Informationen anders verarbeitet
Um den Unterschied zwischen normaler Schusseligkeit und der Vergesslichkeit bei ADHS besser darzustellen, lohnt sich ein Blick auf die zugrunde liegenden psychologischen und neurobiologischen Mechanismen. Während Alltagsaussetzer in der Regel auf vorübergehende Überlastung, Müdigkeit oder situative Ablenkung zurückzuführen sind, liegt, wie eingangs erwähnt, bei ADHS eine chronische Funktionsstörung der exekutiven Funktionen vor. Dieses „Managementsystem des Gehirns“ (Barkley, 2015) umfasst Prozesse wie Planung, Handlungssteuerung, Selbstkontrolle und vor allem das Arbeitsgedächtnis. Die dort auftretenden Defizite sind zentral für viele typische ADHS-Symptome:
- Reduziertes visuell-räumliches und vor allem verbales Arbeitsgedächtnis: Schwierigkeiten, Informationen kurzfristig aktiv zu halten und für Handlungsplanung oder Problemlösung zu nutzen
- Schwaches prospektives Gedächtnis: Probleme, geplante Handlungen zum richtigen Zeitpunkt abzurufen („sich an Vorhaben erinnern“)
- Mangel an innerer Repräsentation: Erschwerter Aufbau mentaler Szenarien oder „innerer Rede“, die für Selbststeuerung und Antizipation nötig ist
- Schnelle Vergänglichkeit von Informationen: Inhalte werden nicht ausreichend konsolidiert, was zu häufigem „Vergessen“ selbst im direkten Kontext führ
Die weniger zuverlässige Abfolge dieser „Organisationsprozesse“ führt u.a. dazu, dass:
- Aufgaben, Termine und Anweisungen trotz Verständnis im jeweiligen Moment vergessen werden
- Eine hohe Ablenkbarkeit durch irrelevante Reize aufgrund mangelnder Aufrechterhaltung von Zielen im Arbeitsgedächtnis vorherrscht
- Viele Aktivitäten begonnen, aber oft nur unter Schwierigkeiten zielgerichtet zu Ende geführt werden
- Es deutlich schwerer ist, Probleme und Konsequenzen künftiger Handlungen einzuschätzen und diese entsprechend an längerfristigen Zielen auszurichten
- Schwierigkeiten mit Selbstorganisation im Alltag (z. B. Schul-/Arbeitsmaterialien, Fristen, Routinen) auftreten und von anderen als Inkompetenz, Unwilligkeit oder Ähnliches wahrgenommen werden
Hinzu kommt eine neurobiologische Komponente: die Störung im Botenstoffe System. Die beiden Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin sind entscheidend für Aufmerksamkeit, Motivation und Gedächtnisprozesse. Diverse wissenschaftliche Arbeiten, z.B. Retz und Rösler (2009), weisen auf die enorme Gewichtung der Störung im dopaminergen System als einer der Schlüsselfaktoren bei ADHS hin. Dopamin ist u.a. entscheidend für Motivation, Belohnungsverarbeitung, inhibitorische Kontrolle und die Weiterleitung von Signalen im Gehirn. Noradrenalin agiert als eine Art „Signal-to-Noise“-Optimierung, die vor allem die Aufmerksamkeit und Wachheit regeln. Ist diese gestört, fällt es schwer, die eigene Aufmerksamkeit über längere Zeit stabil zu halten, gleichzeitig erhöht sich die Ablenkbarkeit durch irrelevante Reize und, es fällt schwerer, zum ursprünglichen Ausgangspunkt zurückzukehren. Serotonin, ein anderer Botenstoff, der vor allem für die emotionale Regulierung zuständig ist, beeinflusst die oft zu beobachtende Impulsivität bei ADHS. Er kann außerdem mit ursächlich für die schnelle Frustration und Stimmungsschwankungen sein, die wiederum die sozialen Interaktionen beeinträchtigen, da die vermeintlich geringe Affektkontrolle von Außenstehenden als etwas Unreifes und Unnatürliches von wahrgenommen wird (Oades, 2007). Andere Botenstoffe, wie Acetylcholin, Glutamat, GABA und andere sollen hier nicht näher ausgeführt werden, da es vor allem das Zusammenspiel von Dopamin und Noradrenalin ist, das viele der klassischen Symptome mit hervorbringt.
Die neurobiologische Grundlage von Vergesslichkeit bei ADHS liegt vor allem in einer veränderten Regulation der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin, die entscheidend für Aufmerksamkeit, Motivation und Gedächtnisprozesse sind. Bei Menschen ohne ADHS sorgen diese Neurotransmitter für eine stabile Signalübertragung im präfrontalen Cortex, also dem Gehirnareal, das für exekutive Funktionen wie Planung, Selbststeuerung und Gedächtnisabruf zuständig ist. Kommt es bei normaler Vergesslichkeit – etwa durch Müdigkeit oder Stress – zu kurzfristigen Schwankungen dieser Botenstoffe, stabilisiert sich das System meist schnell wieder, und die Gedächtnisleistung bleibt insgesamt intakt. Bei ADHS hingegen ist die Dopamin- und Noradrenalin-Ausschüttung dauerhaft dysreguliert: Signale werden schwächer oder unzuverlässiger weitergeleitet, wodurch Informationen nicht effizient gespeichert und abgerufen werden können (Retz & Rösler, 2009). Barkley (2015) beschreibt dies als eine Art „Unterversorgung“ des präfrontalen Cortex, die zu einer chronischen Instabilität in Aufmerksamkeit und Gedächtnis führt. Aus diesem Grund erklärt sich mit die Wirksamkeit von pharmakologischen Ansätzen, wie in anderen Posts herausgestellt. Es erklärt auch, warum Betroffene nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig mit gravierenden Erinnerungslücken kämpfen, während es sich bei normaler Schusseligkeit meist um vorübergehende, situationsbedingte Aussetzer handelt.
Huss (2018) betont, dass Gedächtnisprobleme bei ADHS nicht als individuelle Schwäche oder fehlender Wille zu verstehen sind, sondern als Ausdruck einer klar fassbaren neuropsychologischen Störung. Das hat zwei wichtige Konsequenzen: Zum einen ist Vergesslichkeit bei ADHS deutlich hartnäckiger und folgenreicher als normale Schusseligkeit. Zum anderen wird damit deutlich unterstrichen, dass allein mehr Anstrengung nicht ausreicht, um erfolgreich gegenzusteuern, sondern externe Hilfen, Routinen und therapeutische Ansätze als erweiterte Stützen unerlässlich sind.
Daraus ergibt sich zusammengenommen ein Bild von dysbalancierten Neurotransmittersystemen, die insbesondere in den frontostriatalen und thalamokortikalen Schaltkreisen wirksam sind. Diese Dysregulation erklärt das Nebeneinander von Impulsivität, Ablenkbarkeit, emotionaler Instabilität und defizitärem Arbeitsgedächtnis – also die klinische Realität von ADHS
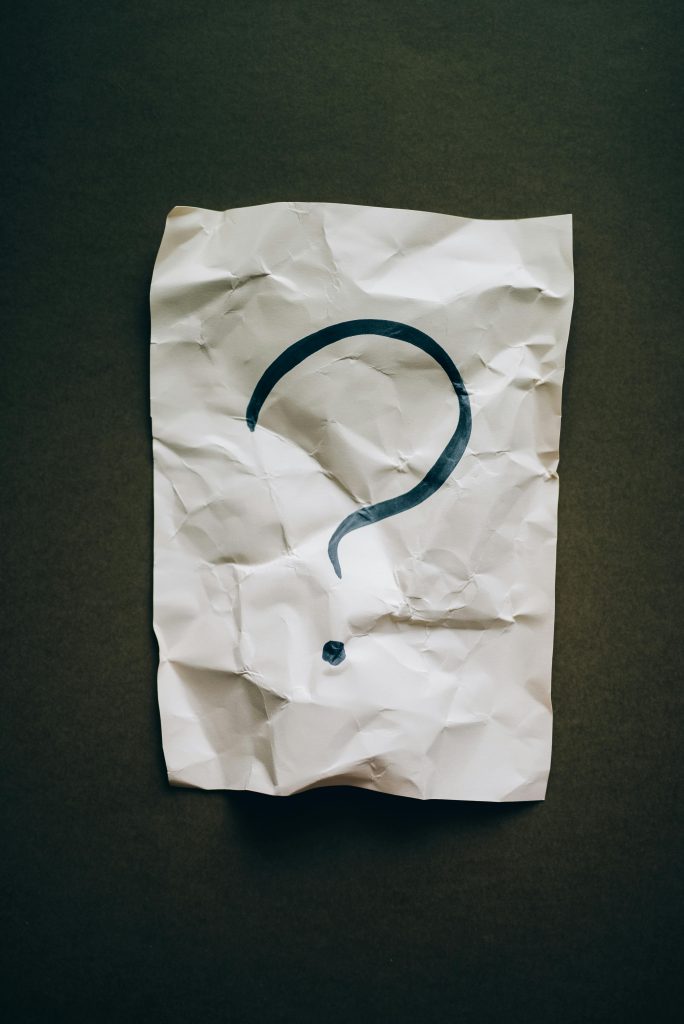
Der Alltag im Dauerstress: Wenn Vergessen nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist
Sowohl im akademischen wie auch im beruflichen Alltag führt die anhaltende Vergesslichkeit bei ADHS zu einer Vielzahl praktischer Probleme. So werden leicht Abgabetermine verpasst, Prüfungstermine geraten in Vergessenheit, da sich das Datum zu weit in der Zukunft befindet (s. Zeitblindheit bei ADHS), oder wichtige Unterlagen finden nicht ihren Weg in die Vorlesung oder wo immer sie benötigt werden. Ähnlich verhält es sich im beruflichen Alltag: Termine werden zwar im Kalender bzw. Teams gespeichert, verschwinden aber kurze Zeit später wieder aus dem Kopf (out of sight, out of mind), Aufgaben werden nicht abgeschlossen, da sprunghaft zwischen verschiedenen offenen Baustellen gewechselt wird, oder Besprechungsinhalte sind kurz nach dem Meeting kaum noch abrufbar, da es zum einen schwierig ist, zu filtern, was relevant und was weniger relevant ist. Zum anderen sind viele Meetings oft mit nicht relevanten Inhalten gefüllt und werden künstlich in die Länge gezogen. Barkley (2015) betont, dass es sich hierbei nicht um gelegentliche Unachtsamkeiten handelt, sondern um ein dauerhaftes Muster, das sich tief in den Alltag einschreibt und ohne Unterstützung zu erheblichen Leistungseinbußen führt. Ebenfalls leiden das Erleben der eigenen Kompetenz wie auch die Wahrnehmung durch andere (Döpfner, 2013).
Während bei nicht betroffenen Personen diese Ereignisse meist nur eine kurzfristige Unannehmlichkeit bedeuten, die sich auch deutlich in ihrer Häufigkeit unterscheidet, können dieselben Situationen bei ADHS-Betroffenen schwerwiegendere Folgen haben. Diesen Prozess der Anhäufung (kleiner) Fehler bezeichnet Barkley (2015) als „kumulative Wirkung exekutiver Dysfunktionen“: Jeder einzelne Aussetzer mag an sich harmlos wirken, doch im Zusammenspiel entsteht für sich eine Spirale aus Verpasstem, Nachholen und erneutem Vergessen. In der Folge erhöht sich die kognitive Belastung zusätzlich, was wiederum das Risiko neuer Gedächtnislücken verstärkt – ein Teufelskreis, der durch sich fortlaufend aufbauenden Druck, von außen, da andere oft mit Unverständnis reagieren und sich selbst, da man in vermeintlich selbst auferlegter Perfektion einen Ausweg sieht, verstärkt wird.
Das sich wiederholende Scheitern an immer denselben Hürden kann starke Frustration hervorrufen. Oder in manchen Fällen zu einem (beständigen) Gefühl der Inkompetenz führen (Huss, 2018; Döpfner et al., 2013), was langfristig das Selbstwertgefühl schwächt. Ein klassisches Beispiel hierfür kann der Rückblick zur eigenen Schulzeit sein; man verspricht seinen Eltern hoch und heilig, es dieses Mal besser zu machen und dass es nicht wieder zu einem Anruf durch den Klassenlehrer während der regulären Schulzeit kommt. Aber kurze Zeit später ist es wieder so weit und das Telefon klingelt Zuhause. In späteren Lebensabschnitten klingelt zwar das Telefon der Eltern nicht mehr, aber die Konsequenzen sind deutlich drastischer. Nicht, weil die Betroffenen nicht wollen, aber weil sie oftmals nicht können bzw. ihnen das Wissen fehlt, wie sie sich selbst Brücken bauen können. Über die Jahre baut sich dieser Druck dann bereits früh auf und wird für manche zu einem hartnäckigen Wegbegleiter.
Um diesen „Fall“ abzufedern, entwickeln viele Menschen mit ADHS einen ausgeprägten Perfektionsdruck. Um die eigenen Defizite und Fehltritte zu kompensieren, werden sich viele übermäßig hohe Standards gesetzt, die teilweise gar nicht erreichbar sind, besonders, wenn es bereits eine Vielzahl von Baustellen gibt. Der Glaube, dass aber exorbitant hohe Ziele mit perfekter Ausführung die vorherigen Fehlschläge ausgleichen, ist ein Trugschluss. Letztlich führt es zu noch mehr Stress (angesichts der Ziele und des damit verbundenen Drucks) und Angst (abermals zu scheitern und es gegenüber sich selbst und Außenstehenden zu rechtfertigen), was sich zu einer „sekundären Störung“, bei der ADHS-bedingte Schwierigkeiten durch emotionale Belastungen verschärft werden, entwickeln kann (Barkley, 2015). Der Teufelskreis wird um ein weiteres Manko erweitert und vertieft sich.
Externe Gedächtnishilfen: Vom Post-it bis zur App
Um sich selbst Abhilfe zu schaffen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine, die die Defizite der EF abfedern kann, ist die Nutzung externer Gedächtnishilfen. Barkley (2015) betont, dass Menschen mit ADHS das Arbeitsgedächtnis nur eingeschränkt nutzen können, weshalb Informationen oft nicht zuverlässig gespeichert oder abgerufen werden. Hinzu kommt, dass einkommende Reize nicht immer direkt zwischen relevant und relevant gefiltert werden können. Indem man in diesem Zusammenhang externe Hilfsmittel als „Erweiterung“ des Gedächtnisses nutzt, helfen diese, Aufgaben und Termine sichtbar und abrufbar zu machen.
Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, Erinnerungen aktiv (und digital) zu unterstützen. So können Termine, Aufgaben und wiederkehrende Routinen unkompliziert über verschiedene Geräte synchronisiert und strukturiert werden, sodass eventuelle kurzfristige Änderungen miterfasst werden. Gleichzeitig lassen sich diverse (wiederholende) Erinnerungen einbauen, sodass die Möglichkeit des Vergessens verringert wird. Dank dieser permanenten Sichtbarkeit und automatischen Erinnerung von Terminen lässt das Arbeitsgedächtnis mehr entlasten Barkley (2015).
Allerdings müssen es nicht nur digitale Lösungen sein. „Klassische“ analoge Varianten wie Notizbücher, Whiteboards oder sticky notes helfen ebenfalls, Erinnerungen & Prioritäten visuell darzustellen und wichtige Informationen sofort verfügbar zu machen. Wichtig ist, dass diese aber nicht an einem Ort platziert werden, wo sie nicht direkt sichtbar sind oder leicht in Vergessenheit geraten. Döpfner et al. (2013) heben hervor, dass besonders bei stark fragmentierter Aufmerksamkeit die physische Präsenz solcher Hilfsmittel das Erinnern deutlich erleichtert.
Letztlich hilft das Externalisieren von Dingen, die man sich merken sollte, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Aufgaben termingerecht erledigt werden. Huss (2018) beschreibt, dass die Kombination aus digitalen und analogen Hilfsmitteln besonders effektiv ist, weil sie sowohl spontane Einfälle als auch geplante Aufgaben abdeckt. Barkley (2015) unterstreicht, dass der konsequente Einsatz externer Gedächtnisstützen eine der wirksamsten Strategien ist, um alltägliche Vergesslichkeit bei ADHS nachhaltig zu reduzieren.
Strukturen, Routinen und Rituale: Stabilität für den Kopf schaffen
Neben externen Gedächtnishilfen spielen feste Strukturen und wiederkehrende Routinen eine entscheidende Rolle, um Vergesslichkeit im Alltag mit ADHS zu reduzieren. Barkley (2015) betont, dass die Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis und in der Selbstorganisation bei ADHS durch konsequent implementierte Abläufe teilweise kompensiert werden können. Das heißt, sofern (selbstständig) durchdachte Routinen erstellt werden, können gewisse Prozesse teilautomatisiert werden, sodass der Übergang von einer Tätigkeit zur anderen leichter fällt, da bereits bekannt ist, was als Nächstes erwartet und benötigt wird.
Ein Beispiel für regelmäßige Abläufe – etwa das vorabendliche Vorbereiten des Rucksacks, das Abhaken und Überarbeiten von Aufgaben auf der To-do-Liste oder das Überprüfen des Kalenders – schaffen eine feste Orientierung im Alltag (Döpfner et al., 2013). Diese Abläufe sollten, sofern möglich, immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, im gleichen Rahmen stattfinden, sodass es keine Ausreden für eventuelle Meinungsänderungen gibt. Huss (2018) beschreibt, dass solche Routinen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wichtige Aufgaben nicht vergessen werden, da sie nicht mehr ausschließlich vom schwankenden Arbeitsgedächtnis abhängen. Barkley (2015) vergleicht dies mit einem „externen Speicher“, der automatisch aktiviert wird, sobald der Ablauf einmal etabliert ist. Des Weiteren schaffen wiederkehrende Abläufe ein Gefühl von Kontrolle und Struktur, was insbesondere bei chronischer Vergesslichkeit und der damit verbundenen Frustration wichtig ist (Huss, 2018; Döpfner et al., 2013).
Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung: Metakognitionen trainieren
Um diesen Prozess zu unterstützen, kann die eigene Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung trainiert werden. Barkley (2015) beschreibt, dass ADHS-Betroffene Schwierigkeiten haben, den eigenen mentalen Zustand zu beobachten. Um diesen Prozess zu unterstützen, kann die eigene Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung trainiert werden. Barkley (2015) beschreibt, dass ADHS-Betroffene Schwierigkeiten haben, den eigenen mentalen Zustand zu beobachten und entsprechend zu steuern. Oftmals reagiert man auf bestimmte Reize und Impulse einfach, ohne dies aber bewusst in jenen Momenten wahrzunehmen. Diese Defizite in den sogenannten Metakognitionen – also der Fähigkeit, über das eigene Denken und Handeln nachzudenken – führen dazu, dass Vergesslichkeit oft unbemerkt bleibt, bis sie bereits negative Folgen hat.
Indem man lernt, die eigene Aufmerksamkeit bewusst auf einen aktuellen Moment zu lenken, können impulsive Handlungen unterbrochen werden. Döpfner et al. (2013) weisen darauf hin, dass dadurch gelernt werden kann, den Moment zwischen Ablenkung und Handlung bewusster wahrzunehmen. Dieses „Innehalten“ wirkt wie ein mentales Stopp-Signal, das verhindert, dass wichtige Inhalte im Arbeitsgedächtnis durch neue Reize überschrieben werden. Was in der Theorie einfach klingt, ist für viele Menschen mit ADHS in der Praxis deutlich schwieriger. Aber wie kommt es dazu?
Ein Erklärungsansatz ist über das Modell der „Reizinterferenz“. Nach diesem sind die Filtermechanismen im präfrontalen Cortex nur schwach ausgeprägt, wodurch irrelevante Reize nicht ausreichend unterdrückt werden können (Barkley, 2015). Sobald ein neuer Reiz auftritt, kann dieser zum einen nicht direkt nach Relevanz gefiltert werden, zum anderen und das ist vermutlich die eigentliche Crux, fällt es ungemein schwerer, wieder zum vorherigen Status quo zurückzukehren. Zwar lässt es sich ähnlich wie beim Muskeltraining durch gezielte und wiederholte Übungen stärken (D’Alessio, 2012), bedarf jedoch einiger Zeit.
Was bedeutet dies für den Alltag? Um die alltäglichen Probleme, die mal häufiger, mal weniger häufig auftreten, in den Griff zu bekommen, empfiehlt es sich, sich bewusst zu machen, was einen am häufigsten ablenkt und in welchen Situationen tritt es auf? Vor allem bei Studenten, die mit uns arbeiten, hören wir oft, dass Smartphones, soziale Medien und auditive und visuelle Geräuschkulissen schnell zu einer Überladung führen. Verstärkt wird dies dadurch, dass sie sich dieser Ablenkungen zwar bewusst sind, aber entweder nicht immer entsprechend reagieren oder aber die grundsätzliche Wissen im Umgang hierzu fehlt (Huss, 2018).
Nachdem man diese Szenarien und Faktoren identifiziert hat, können sie je nach Schweregrad gewichtet werden. Anschließend werden die, die die größte Belastung darstellen, zuerst fokussiert und anhand simpler, wenn-dann Regeln, Maßnahmen vorbereitet:
- Wenn ich in der Unibib angekommen bin, dann schließe ich das Smartphone mit im Spind ein und nutze es nur in den Pausen
- Wenn ich merke, dass der Arbeitsplatz zu viel visuelle Reizüberflutung bietet, dann suche ich mir einen anderen, bevor ich beginne
- Wenn ich das Gefühl habe, rastlos und mit meinen Gedanken umherzuirren, dann werde ich eine kurze Pause einlegen und eine Runde ums Gebäude laufen
- Wenn der Akkustikpegel dort für mich zu laut ist, dann arbeite ich mit Noise-cancelling Kopfhörern oder Earopacks weiter
Diese Regeln müssen keine komplex ausformulierten Gesetzesbücher wie das BGB [1] sein. Sie sollen lediglich dazu dienen, sich selbst gedanklich daran zu erinnern, was man sich vorgenommen hat und wie man entsprechend auf mögliche Änderungen reagieren will. Krause und Krause (2016) betonen, dass klare, gesprochene Anweisungen an sich selbst („Erst die Aufgabe fertigstellen, dann das Handy benutzen“)[2] die Selbstkontrolle stärken können. Diese Technik basiert darauf, dass die verbale Selbstlenkung exekutive Funktionen teilweise ersetzt und so das Gedächtnis stabilisiert; eine interne Schwäche wird durch eine externe, verbale Strategie kompensiert (Barkley, 2015). Wichtig ist, sie kurz und prägnant zu halten. Unnötig komplizierte Regeln oder Formulierungen von Fällen sind hierbei kontraproduktiv.

Zweitens kann der Arbeitsbereich so eingerichtet werden, dass nur die aktuell benötigten Materialien vorhanden sind. Alles andere wird zur weggeräumt bzw. gar nicht erst mitgebracht. Das heißt für die Zeit in der Unibib, dass nur die benötigten Werke, Unterlagen etc. auf dem Tisch liegen bzw. am Arbeitsplatz, dass nur die benötigten Programme und Dokumente geöffnet sind. Alles andere bleibt geschlossen und Benachrichtigungen werden, sofern möglich, auf stumm gestellt.
Hier kann ebenfalls wieder das wenn-dann Prinzip angewendet werden, indem man sich selbst niederschreibt bzw. immer wieder in Erinnerung ruft, wenn man auf die Notiz blickt, was für welche Aufgabe benötigt wird; wenn ich XYZ machen will, dann benötige ich A, B und C. Je strukturierter man hierbei vorgeht und sich eine reizarme Umgebung schafft, desto leichter fällt es, den Fokus zu halten (Döpfner et al., 2013).
Zusätzlich können bewusst platzierte Erinnerungsreize helfen. Dazu zählen Post-its an zentralen Orten, Checklisten auf dem Schreibtisch oder digitale Reminder an genau den Zeitpunkten, an denen sie gebraucht werden, die wie „Erinnerungsinseln“ wirken (Barkley, 2015). In Verbindung mit der Pomodoro-Technik lassen sich diese in regelmäßigen Abständen überprüfen und evaluieren, wie gut es bisher funktioniert.
Zuletzt seien kurze Achtsamkeitspausen vor dem Start einer Aufgabe erwähnt. Kurzgefasst, versucht man sich selbst, bevor man mit der Aufgabe beginnt, selbst zu vergewissern, wo man sich gerade befindet, was geplant ist und wie man diese Aufgabe angehen will. Es soll helfen, sich klarzumachen, dass jetzt der nächste Teil dran ist. Auch das Führen eines „Gedankenprotokolls“ kann helfen, indem es als Evaluationsbasis dafür, was gut lief, was weniger gut lief und warum, dient. Welche Gedanken waren vorherrschend, als etwas passierte, wie fühlte man sich dabei, was war der Auslöser dafür etc. Je präziser man diese Ursachen für sich reflektieren und benennen kann, desto mehr kann man nachfolgend Anpassungen treffen, um es sich selbst leichter zu machen und den Stress zu reduzieren (Huss, 2018).
[1] Bürgerliches Gesetzbuch
[2] kursive Hervorhebung seitens des Blogautors
Soziale Unterstützung und Motivationsfaktoren
Das soziale Umfeld kann einen entscheidenden Beitrag bei der Unterstützung leisten. Das Gestalten und Implementieren von individuellen Strategien ist nur ein Teil, die Unterstützung von außen der andere. Als „soziale Gedächtnisstütze“ können Freunde, Familie, Kollegen oder Therapeuten und Coaches fungieren (Barkley, 2015). Diese unterstützen über die Zeit hinweg nicht nur, sondern fungieren halten die jeweilige betroffene Person mit ADHS auch haftbar, d.h. stellen sicher, dass diese den gemeinsam vereinbarten Zielen auch nachkommen. Dabei geht es nicht um totale Kontrolle oder Schaffung von Abhängigkeiten, sondern um den gezielten Einsatz von sozialer Interaktion als Verstärker, Erinnerungsanker und Feedbackschleife.
D’Alessio (2012) betont, dass soziale Kontexte die Selbstregulation positiv beeinflussen können, indem sie Strukturen schaffen, die den Betroffenen helfen, Ziele im Gedächtnis präsent zu halten. Verabredungen, gemeinsame Arbeitsgruppen oder das Teilen von Aufgabenlisten mit Kommilitonen und Kollegen können als „soziale Verpflichtung“ wirken. Diese externe Einbettung führt dazu, dass Aufgaben nicht nur intern erinnert werden müssen, sondern durch soziale Erwartungen und Verpflichtungen gestützt sind (Krause und Krause, 2016). Der Gedanke, jemand anderem Rechenschaft schuldig zu sein, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Aufgaben erledigt werden, selbst wenn die eigene intrinsische Motivation schwankt. Auf neurobiologischer Ebene spielt hier das dopaminerge Belohnungssystem eine Rolle: Soziale Anerkennung und Verbindlichkeit aktivieren Belohnungszentren, wodurch das Erinnern an die Aufgabe im Arbeitsgedächtnis verstärkt wird.
Im Alltag können sogenannte „Accountability-Partner“ sich regelmäßig über ihre Aufgaben austauschen und gegenseitig erinnern und motivieren. Auch in beruflichen Teams sind kurze Check-ins oder Stand-up-Meetings hilfreich, weil sie die Gedächtnisleistung nicht dem Einzelnen überlassen, sondern soziale Kontrollmechanismen etablieren. D’Alessio (2012) hebt hervor, dass die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben zudem emotionale Entlastung schafft – ein Faktor, den auch Huss (2018) als zentral beschreibt, um die Frustrationsspirale aus Vergesslichkeit und Selbstzweifeln zu durchbrechen. Das wiederum bremst den Teufelskreis und zweifelhaften Drang nach Perfektionismus, mit dem vorherige Rückschläge kompensiert werden sollen.
Fazit
Vergesslichkeit ist ein Phänomen, das jeder kennt – sei es das Liegenlassen des Schlüssels oder das Übersehen eines Termins – und das jedem bereits mehrmals im Leben passiert ist. Bei gesunder Schusseligkeit handelt es sich meist um situative Überlastung, Müdigkeit oder Stress: Das Arbeitsgedächtnis ist kurzfristig beansprucht, die Aufmerksamkeit nur begrenzt verfügbar.
Bei ADHS hingegen liegen tiefergehende neurobiologische Ursachen zugrunde. Forschungsarbeiten, insbesondere von Barkley und Kollegen, verdeutlichen, dass Störungen in dopaminergen, noradrenergen und weiteren Neurotransmittersystemen die Fähigkeit beeinträchtigen, Informationen im Arbeitsgedächtnis stabil zu halten, Handlungen zeitlich zu organisieren und Impulse zu kontrollieren. Vergesslichkeit ist hier nicht nur zufällig, sondern Ausdruck einer strukturellen Schwäche exekutiver Funktionen.
Für den Alltag bedeutet das:
- Bei normaler Schusseligkeit helfen meist einfache Routinen (z. B. feste Ablageorte, To-do-Listen, Entlastung durch Pausen).
- Bei ADHS sind umfassendere Strategien notwendig: strukturierende Hilfsmittel (digitale Kalender, Erinnerungs-Apps), klare Routinen, externe Unterstützung und – wo indiziert – medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung.
Das Verständnis des Unterschieds ist entscheidend: Während Schusseligkeit ein situatives Ärgernis bleibt, ist ADHS eine entwicklungsneurologische Störung, die ernst genommen und behandelt werden sollte. Nur so lassen sich die Betroffenen nicht auf „vergesslich“ reduzieren, sondern in ihrer gesamten Funktionsweise verstehen – und wirksam im Alltag unterstützen. Das es aber behandelbar ist zeigt ebenfalls, dass es weder als Ausrede genutzt werden sollte („ich habe ADHS, ich kann nun mal nicht anders“) noch als Stigmata („der kann halt nicht anders, der ist so“. Es handelt sich um eine sehr gut behandelbare Beeinträchtigung, die mit etwas Planung und Organisation im Alltag gut handelbar ist. Es bleibt allerdings eine Frage des Wollens – will man sich diesem Problem stellen und entsprechende Maßnahmen ergreifen oder will man sich lieber darauf berufen, dass man nicht anders kann und damit immer einen Teil des eigenen Potenzials liegen lassen? Diese Frage kann jeder nur für sich selbst beantworten und entsprechend sein Leben ausrichten. Aber es ist keinesfalls eine Schande, sich dieser Fehler bewusst zu werden und entsprechende Hilfen anzunehmen.

Quellen
- Arnsten, A. F. T. (2009). The emerging neurobiology of attention deficit hyperactivity disorder: The key role of the prefrontal association cortex. Journal of Pediatrics, 154(5), I–S43. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2009.01.018
- Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1–29. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422
- Barkley, R. A. (2015). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th ed.). New York: Guilford Press
- Barkley, R. A. (2020). Executive Functions: What They Are, How They Work, and Why They Evolved. New York: Guilford Press
- Döpfner, M. (2017). Störungen des Sozialverhaltens und ADHS bei Kindern und Jugendlichen. Hogrefe
- Huss, M. (2018). ADHS im Erwachsenenalter: Symptome, Diagnostik, Therapie. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
- Kirova, A.-M., Bays, R. B., & Lagalwar, S. (2015). Working memory and executive function decline across normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer’s disease. BioMed Research International, 2015, 748212. https://doi.org/10.1155/2015/748212
- Killgore, W. D. S. (2010). Effects of sleep deprivation on cognition. Progress in Brain Research, 185, 105–129. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53702-7.00007-5
- Kofler, M. J., Irwin, L. N., Soto, E. F., Groves, N. B., Harmon, S. L., & Sarver, D. E. (2018). Executive functioning heterogeneity in pediatric ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 46(5), 273–286. https://doi.org/10.1007/s10802-017-0310-z
- Krause, J., & Krause, K.-H. (2014). ADHS im Erwachsenenalter: Symptome, Differentialdiagnose, Therapie. Schattauer
- McDaniel, M. A., & Einstein, G. O. (2007). Prospective memory: An overview and synthesis of an emerging field. Thousand Oaks, CA: Sage
- Oades, R. D. (2007). Role of the serotonin system in ADHD: Neurochemical and neuropharmacological perspectives. Current Pharmaceutical Design, 13(27), 3178–3194. https://doi.org/10.2174/138161207782794263
- Philipsen, A. (2017). ADHS im Erwachsenenalter: Evidenzbasierte Diagnostik und Therapie. Stuttgart: Schattauer
- Retz, W., & Rösler, M. (2009). Neurobiologie der ADHS: Von den Genen zur Therapie. Stuttgart: Schattauer
- Volkow, N. D., Wang, G.-J., Newcorn, J., et al. (2007). Brain dopamine transporter levels in treatment and drug naive adults with ADHD. NeuroImage, 34(3), 1182–1190. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.10.011

Schreibe einen Kommentar