Einleitung
ADHS betrifft weit mehr als nur Aufmerksamkeit und Impulssteuerung – es beeinflusst den gesamten Alltag: von der Planung über die Ernährung bis hin zur körperlichen Aktivität. Viele Betroffene berichten, dass es ihnen schwerfällt, Routinen aufzubauen, Energie über den Tag zu halten und einen gesunden Lebensrhythmus zu finden. Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Studien zunehmend, dass Faktoren wie Ernährung, Bewegung und Schlaf direkt auf die neurobiologischen Mechanismen wirken, die bei ADHS eine Rolle spielen. Eine bewusste Gestaltung dieser Lebensbereiche kann daher einen spürbaren Einfluss auf Konzentration, Stimmung und Leistungsfähigkeit haben (Döpfner, 2021; Philipsen & Hesslinger, 2019).
Ein strukturierter Alltag mit ausgewogener Ernährung und regelmäßiger Bewegung kann nicht nur Symptome abmildern, sondern auch zu mehr Selbstwirksamkeit führen – einem zentralen Aspekt im Umgang mit ADHS. Statt kurzfristiger Motivation geht es um nachhaltige Routinen, die Energie spenden und Stabilität fördern. Besonders Bewegung wirkt hier doppelt: Sie fördert die Ausschüttung von Dopamin und Serotonin, verbessert die kognitive Leistungsfähigkeit und hilft gleichzeitig, Stress abzubauen. Kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung – reich an Proteinen, Vitaminen und komplexen Kohlenhydraten – entsteht eine stabile Grundlage für Fokus und Ausgeglichenheit im Alltag.
Dieser Blogbeitrag nimmt daher drei zentrale Säulen in den Blick, die gemeinsam einen gesunden Rahmen für den Alltag mit ADHS bilden können:
- Was steckt in unserem Essen?: Welche Bestandteile moderner Ernährung – etwa Zucker, Farbstoffe oder stark verarbeitete Lebensmittel – wirken sich negativ auf Konzentration und Stimmung aus?
- Das Zusammenspiel von Ernährung und Gehirn: Wie beeinflussen Nährstoffe, Blutzuckerspiegel und Mikrobiom die neurobiologischen Prozesse bei ADHS?
- Praktische Umsetzung im Alltag: Wie lassen sich gesunde Ernährung, Bewegung und Struktur realistisch in den Alltag integrieren – durch Meal Prep, Routinen und sportliche Planung?
Ziel dieses Beitrags ist es, zu zeigen, dass gesunde Ernährung und Bewegung keine zusätzlichen Belastungen sein müssen, sondern Hilfsmittel zur Selbststeuerung und zum Ausgleich. Mit dem richtigen Verständnis und kleinen, konsequenten Schritten kann jeder Betroffene Wege finden, Körper und Geist in Einklang zu bringen – und den Alltag mit ADHS nachhaltiger und stabiler zu gestalten
1. Was steckt in unserem Essen?
Wenn man verstehen will, wie Ernährung mit ADHS zusammenhängt, sollte man zunächst betrachten, wie sich moderne Essgewohnheiten in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Vor allem in industrialisierten Ländern stammen heute große Teile der täglichen Kalorienzufuhr aus sogenannten stark verarbeiteten Lebensmitteln („ultra-processed foods“). Dazu zählen Fertigprodukte, Tiefkühlgerichte, Snacks, Süßwaren, Softdrinks, Fast Food, aber auch vermeintlich gesunde Produkte wie aromatisierte Müsliriegel oder zuckerreduzierte Getränke. Diese Lebensmittel sind oftmals reich an schnell verfügbaren Kohlenhydraten, gesättigten Fetten und Salz, enthalten jedoch kaum Vitamine, Mineralstoffe oder Ballaststoffe oder ähnliches, was in Ansätzen gesund ist. Diese Inhaltsstoffe lösen nicht nur Veränderungen im Körper, sondern auch auf die Funktionen des Gehirns aus – insbesondere bei Menschen mit ADHS, deren neuronale Regulation ohnehin empfindlicher auf Schwankungen reagiert (Döpfner & Lehmkuhl, 2015).
Zucker und schnelle Kohlenhydrate gehören zu den zentralen Belastungsfaktoren. Sie führen zu raschen Blutzuckerspitzen, gefolgt von einem abrupten Abfall – ein Vorgang, der mit Müdigkeit, Reizbarkeit und Konzentrationsproblemen einhergehen kann. Da Zucker heutzutage in vielen industriellen Lebensmitteln vorkommen, ist es schwierig, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Studien weisen darauf hin, dass Kinder mit ADHS auf diese Schwankungen besonders sensibel reagieren, da der Glukosestoffwechsel eng mit der dopaminergen Signalübertragung verknüpft ist (Döpfner, 2021). Eine Ernährung mit hohem Zuckeranteil und Süßstoffen kann somit kurzfristig Energie liefern, langfristig jedoch zu stärkerer Impulsivität und Leistungseinbrüchen führen sowie langfristig auch den Dopaminhaushalt beeinflussen – ein Neurotransmittersystem, das bei ADHS ohnehin sensibel und teilweise dysreguliert ist (Philipsen & Hesslinger, 2019). Vor allem in Berufen mit hohem Stressfaktor, z.B. im Gesundheits- und Finanzwesen, können diese rapiden An- und Abstiege die Leistungsfähigkeit erheblich beeinflussen, was sich …
Künstliche Farbstoffe und Konservierungsmittel stellen einen weiteren problematischen Bestandteil vieler moderner Lebensmittel dar. Farbstoffe wie Tartrazin (E102) oder Allurarot (E129) werden häufig in Süßwaren, Getränken oder Fertigprodukten eingesetzt, um Produkte ansprechender erscheinen zu lassen. Zahlreiche Untersuchungen, unter anderem aus Großbritannien und den Niederlanden, zeigen, dass diese Stoffe bei einer Teilgruppe von Kindern zu gesteigerter Unruhe und Aufmerksamkeitsproblemen führen können (McCann et al., 2007; Nigg et al., 2012). Auch wenn die Effekte individuell unterschiedlich ausfallen, gehen viele Experten inzwischen davon aus, dass ein sensitives Subkollektiv existiert, das besonders stark auf solche Zusatzstoffe reagiert. In der klinischen Praxis wird deshalb empfohlen, bei Verdacht auf Unverträglichkeiten eine zeitlich begrenzte Eliminationsphase in Absprache mit Ärzten oder Ernährungsfachkräften zu prüfen (Döpfner, 2022). Diese können helfen, eventuelle Unverträglichkeiten und Schwierigkeiten herauszufiltern.
Darüber hinaus enthalten stark verarbeitete Produkte häufig Transfette und gehärtete Öle, die Entzündungsprozesse im Körper fördern und die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke beeinflussen können. Laut Döpfner (2022) wird vermutet, dass solche Veränderungen die neuronale Signalübertragung beeinträchtigen und damit indirekt auch kognitive Prozesse negativ beeinflussen können. In Kombination mit Bewegungsmangel, unregelmäßigen Mahlzeiten und Schlafdefiziten entsteht ein Lebensstil, der die Symptomatik von ADHS zusätzlich verschärfen kann.
Ultra-processed foods enthalten neben Zucker und Farbstoffen oft gehärtete Fette, Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe, die das natürliche Gleichgewicht des Körpers beeinflussen. Neben der Nährstoffverarmung wirken sich diese Produkte häufig negativ auf das Darmmikrobiom aus – ein Bereich, der zunehmend als möglicher Einflussfaktor bei ADHS diskutiert wird (Philipsen & Hesslinger, 2019). Ein unausgeglichenes Mikrobiom kann die Signalübertragung zwischen Darm und Gehirn verändern und Entzündungsprozesse fördern, die wiederum die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können.

Ein Gegenmodell zu diesen Ernährungsformen bieten natürliche, unverarbeitete Lebensmittel: frisches Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, hochwertige Pflanzenöle und eiweißreiche Nahrungsmittel wie Fisch und Eier. Diese enthalten komplexe Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel stabil halten, sowie Mikronährstoffe wie Zink, Eisen und Magnesium, die für die Neurotransmitterbildung von zentraler Bedeutung sind. In verschiedenen Beobachtungsstudien wurde festgestellt, dass Personen mit einem „mediterranen“ Ernährungsstil – also mit hohem Anteil an frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln – tendenziell weniger stark ausgeprägte ADHS-Symptome zeigen (Lange et al., 2023).
Zusammengefasst deutet die Forschung darauf hin, dass moderne Ernährungsweisen mit hohem Anteil an Zucker, Farbstoffen und verarbeiteten Lebensmitteln die Symptomatik von ADHS verstärken können – zumindest bei einem Teil der Betroffenen. Das bedeutet nicht, dass Ernährung allein die Ursache ist, wohl aber, dass sie ein bedeutender Faktor sein kann. Der bewusste Verzicht auf stark verarbeitete Produkte und die Hinwendung zu frischen, nährstoffreichen Lebensmitteln stellen daher einen ersten, wirksamen Schritt dar, um die eigene Aufmerksamkeit und das eigene Wohlbefinden zu stabilisieren.
II. Wie wirken Zucker, Farbstoffe und verarbeitete Lebensmittel auf das Gehirn bei ADHS?
ADHS ist im Kern eine neurobiologische Störung, bei der die Regulation von Aufmerksamkeit, Motivation und Impulskontrolle beeinträchtigt ist. Zentral beteiligt sind dabei Neurotransmittersysteme, insbesondere Dopamin und Noradrenalin, die in bestimmten Hirnregionen – etwa dem präfrontalen Cortex und den Basalganglien – eine zentrale Rolle spielen (Döpfner, 2021; Barkley, 2014). Ernährung kann diese Systeme zwar nicht direkt „verändern“ oder permanent „reparieren“, wohl aber über biochemische Wege beeinflussen, die auf die Verfügbarkeit von Nährstoffen, Energie und Neurotransmittervorstufen wirken.
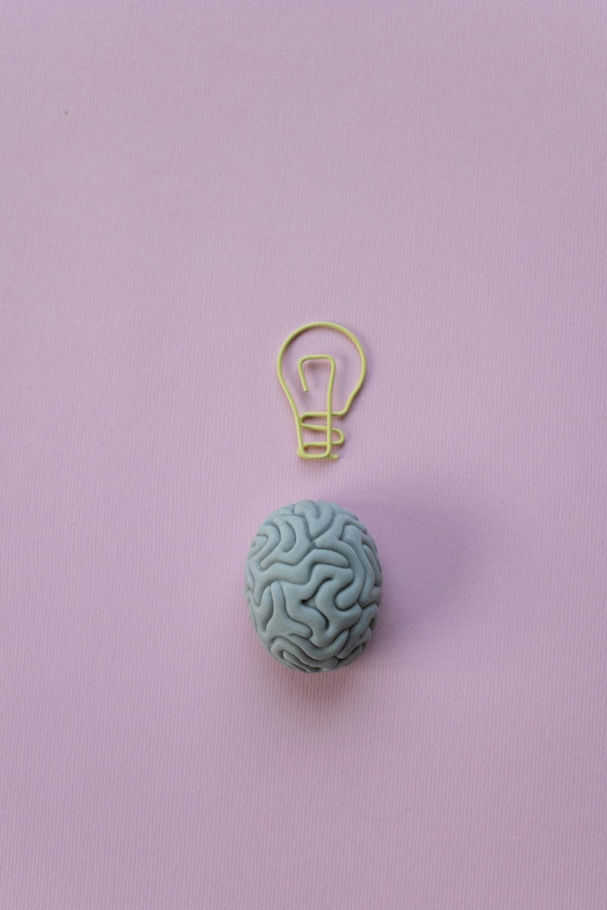
Zucker und Blutzuckerschwankungen haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Gehirnaktivität. Grundsätzlich ist das Gehirn auf eine kontinuierliche Glukosezufuhr angewiesen, die bei stark schwankenden Blutzuckerwerten aber zu kurzfristigen Phasen von Energiemangel führen kann. Besonders bei ADHS kann dies zu Reizbarkeit, Konzentrationsabfall und impulsivem Verhalten führen. Döpfner (2022) weist darauf hin, dass diese instabile Energiebereitstellung die ohnehin vorhandenen Defizite in der Selbstregulation zusätzlich belastet. Zwar können leicht zugängliche Lebensmittel (i.d.R. fast-food oder processed foods) viele schnelle Kohlenhydrate bereitstellen, die zu einer kurzfristigen Dopaminfreisetzung führen, auf die aber ein rascher Abfall folgt. Besonders die Impulsivität bei ADHS dies leicht begünstigen und damit gleichzeitig ein ungünstiges Verhaltensmuster kurzfristiger Belohnung verstärken.
Künstliche Farbstoffe und Konservierungsstoffe wirken nicht direkt auf Dopamin oder Noradrenalin, können aber über sekundäre Mechanismen neuronale Prozesse beeinflussen. Einige Farbstoffe stehen im Verdacht, oxidativen Stress zu fördern oder entzündliche Prozesse zu begünstigen, die wiederum die neuronale Signalübertragung stören können (Nigg et al., 2012). Zudem deuten Untersuchungen darauf hin, dass Kinder mit ADHS in bestimmten Fällen eine erhöhte Sensitivität gegenüber Additiven zeigen, was auf individuelle Unterschiede in Stoffwechsel und Neurotransmitterhaushalt hinweist (Döpfner & Lehmkuhl, 2015). In der klinischen Praxis wird daher zunehmend empfohlen, bei auffälligen Verhaltensänderungen nach dem Konsum solcher Produkte mögliche Zusammenhänge kritisch zu prüfen.
Darüber hinaus rückt das Gehirn-Mikrobiom-System immer stärker in den Fokus. Der Darm beherbergt Milliarden von Bakterien, die an der Produktion von Neurotransmittern, an der Immunregulation und an der Aufnahme von Nährstoffen beteiligt sind. Studien zeigen, dass eine unausgewogene Ernährung mit hohem Zucker- und Fettanteil das Mikrobiom verändern kann – was wiederum über Entzündungsbotenstoffe und Stoffwechselveränderungen auf die Gehirnfunktion wirkt (Lange et al., 2023). So kann ein gestörtes Mikrobiom die Produktion wichtiger Neurotransmittervorstufen (wie Tryptophan und Tyrosin) beeinträchtigen und Entzündungsprozesse im Körper fördern kann (Philipsen & Hesslinger, 2019). Diese Erkenntnisse stützen die Annahme, dass Ernährung und psychisches Wohlbefinden eng miteinander verknüpft sind – auch bei ADHS.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Mikronährstoffe, die im Gehirnstoffwechsel eine regulierende Funktion haben. Eisen, Zink, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren spielen eine zentrale Rolle in der Bildung und Funktion von Neurotransmittern. Ein Mangel an diesen Nährstoffen kann die Signalübertragung im Gehirn beeinträchtigen und ADHS-Symptome verstärken. Insbesondere Omega-3-Fettsäuren, wie sie in fettreichem Fisch oder Leinöl vorkommen, haben eine leicht positive Wirkung auf Aufmerksamkeit und emotionale Stabilität (Philipsen & Hesslinger, 2019; Döpfner, 2022). Die Wirkung ist zwar moderat, aber wissenschaftlich gut belegt, weshalb eine ausgewogene Ernährung mit regelmäßiger Aufnahme dieser Fette zu empfehlen ist.
Die zuvor erwähnten Entzündungsprozesse sind und werden ebenfalls durch stark verarbeitete Lebensmittel und ein Übermaß an gesättigten Fetten gefördert. Umgekehrt wirken die zuvor erwähnten Omega-3-Fettsäuren sowie Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe entzündungshemmend und unterstützen die neuronale Kommunikation. Dieser Zusammenhang verdeutlicht, dass Ernährung nicht nur eine Frage der Energiezufuhr und des persönlichen Wohlbefindens ist, sondern tief in die Funktionsweise des zentralen Nervensystems eingreift.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Ernährung wirkt bei ADHS nicht isoliert, sondern über komplexe Stoffwechsel- und Signalwege auf das Gehirn. Hohe Zuckerzufuhr, künstliche Zusatzstoffe und stark verarbeitete Produkte können bestehende neuronale Ungleichgewichte verstärken, während ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung die Stabilität von Aufmerksamkeit, Stimmung und Impulskontrolle fördern können. Die Ernährung ersetzt keine Therapie (!), kann aber ein stabilisierendes Fundament schaffen, auf dem andere Behandlungsbausteine besser greifen.
III. Gesunde Ernährung im Alltag: Struktur, Meal-Prep und stabile Rhythmen bei ADHS
Nachdem deutlich geworden ist, wie stark Ernährung und ADHS miteinander verwoben sind, stellt sich die entscheidende Frage: Wie lässt sich gesunde Ernährung im Alltag leichter umsetzen – trotz Zeitdruck, Konzentrationsproblemen, impulsivem Essverhalten und anderen Faktoren? Gerade Menschen mit ADHS fällt es oft schwer, langfristig Routinen einzuhalten, regelmäßig zu essen und vorausschauend zu planen. Deshalb ist es hilfreich, Ernährung nicht als disziplinbasiertes Ziel, sondern als strukturierbares System zu verstehen.
Ein wesentlicher Ansatzpunkt ist die Vorbereitung – das sogenannte Meal Prep. Darunter versteht man das gezielte Planen und Vorbereiten von Mahlzeiten im Voraus, meist für mehrere Tage. Studien und klinische Beobachtungen zeigen, dass feste Strukturen und vorhersehbare Abläufe die Selbststeuerung bei ADHS erleichtern (Döpfner, 2021). Wenn gesunde Mahlzeiten bereits vorbereitet sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit, in Momenten von Stress oder Erschöpfung zu zwar schnell verfügbaren, aber stark verarbeiteten Lebensmitteln zu greifen. So kann beispielsweise am Wochenende neben dem (beruflichen und privaten) Plan für die kommende Woche auch das Essen miteingeplant werden: Was wird wann gekocht? Wie viele Portionen werden es? Was wird dafür benötigt? Wann wird der Einkauf erledigt? Wann wird gekocht? Sobald man diese Eckpfeiler für sich beantwortet hat, kann man beginnen, es umzusetzen: Zum Beispiel werden statt einzelnen Portionen größere Mengen gekocht, die dann für mehrere Tage eingeteilt werden. Das erspart den Stress, den sich viele machen, wenn sie daran denken, was alles nach der Arbeit noch ansteht und hilft, ungesunde Alternativen zu vermeiden. Sollte man dennoch zwischendurch Heißhunger verspüren, sollten wenn gesunde Snacks wie Nüsse, Gemüsesticks oder Vollkornprodukte vorgehalten werden.

Darüber hinaus spielt die Rhythmisierung des Essverhaltens eine zentrale Rolle. Menschen mit ADHS neigen dazu, Mahlzeiten auszulassen oder unregelmäßig zu essen – häufig, weil sie sich zu vertieft im Hyperfokus befinden oder den Überblick verloren haben. In der Folge wird panisch versucht, die Ordnung wiederherzustellen, alles andere wird diesem Ziel untergeordnet. Dass es besser wäre, einen Moment innezuhalten und die Konzentration erst wiederherzustellen, wird dabei unbewusst oftmals übersehen. Existiert ein stabiler Essrhythmus, kann dieser helfen, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und Leistungsschwankungen zu vermeiden, indem dieser in regelmäßigen Pausen aufgefrischt wird und ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen wird, um Dehydrierung zu vermeiden. Döpfner (2022) empfiehlt, feste Essenszeiten als Teil der Tagesstruktur zu etablieren und sie mit anderen Routinen zu verknüpfen, beispielsweise mit Arbeitsbeginn oder Pausenritualen. Auch das Einführen visueller Erinnerungen (Kalender, Handy-Reminder, Whiteboards) kann helfen, Ernährung in den Alltag zu integrieren.
Wie zuvor erwähnt, kann das Bewusstsein für den Moment von großer Tragweite sein. Da Menschen mit ADHS oftmals sehr anfällig für neu auftretende Reize sind und zuvor begonnene Tätigkeiten in der Folge nicht immer zu Ende geführt werden, kann es die situative Problematik verschärfen. Wenn zum Beispiel eigentlich gegessen werden sollte, es aber zu Ablenkungen, z.B. durch das Smartphone oder Videos, die während dem Essen laufen lassen will, kommt, kann es dazu führen, dass entweder stattdessen der Fokus gänzlich woanders hin gerichtet ist oder Sättigungssignale übergangen werden. Im Zweifel wird eine Mahlzeit zu sich genommen, kurze Zeit später setzt aufgrund des fehlenden Sättigungsgefühls aber wieder der Hunger ein. Achtsames Essen – etwa durch bewusstes Kauen, Essen ohne (digitale!) Ablenkung oder kurze Pausen während der Mahlzeit – kann nicht nur die Selbstwahrnehmung verbessert werden. Es verbessert gleichzeitig auch die Impulskontrolle und emotionale Regulation, die ebenfalls in anderen Bereichen wichtig ist (Philipsen & Hesslinger, 2019).
Neben Strukturierung und bewusster Wahrnehmung sollte auch die Lebensmittelauswahl realistisch und pragmatisch bleiben. Statt das Allheilmittel in radikalen Diäten oder restriktiven Plänen zu suchen, ist es hilfreicher, sich schrittweise vorzuarbeiten und Veränderungen einzuführen. So lässt sich ein Ziel gemäß der SMART-Methode definieren und in kleine Blöcke aufteilen, deren Fortschritt zur Motivationsunterstützung über die Zeit dokumentiert werden kann. Dabei kann u.a. der Zuckerkonsum kontrolliert werden, mit dem Ziel, diesen zu reduzieren; wie oft greift man zu Softdrinks statt zu Wasser? Wie oft gönnt man sich Gebäck oder andere Süßigkeiten, statt Obst? Am Ende sollte die Ernährung einem Plan folgen, der auf Balance statt Perfektion setzt, und sich nachhaltig in den Alltag integrieren lässt. Ergänzend kann das Führen eines Ernährungstagebuchs helfen, in dem Beobachtungen zwischen Ernährung, Stimmung und Konzentration niedergeschrieben werden, um zu erkennen, was sich wie über den Tag hinaus auswirkt (Döpfner & Lehmkuhl, 2015).
Letztlich sollte Ernährung als Teil eines ganzheitlichen Selbstmanagements verstanden werden, in dem das Zusammenspiel aus ausreichendem Schlaf, aktiver Bewegung und Stressreduktion mit zusammen einhergeht. Durch den gesunden Schlafrhythmus verfestigt sich ein stabileres Hunger- und Sättigungsgefühl, was impulsives Essen reduziert. Gleichzeitig kann man sich selbst für erfolgreiche Anpassungen über natürlichen Fruchtzucker „belohnen“. Anfänglich mag es schwer wirken, diesen Teil der Routine umzusetzen, was aber mit der Zeit im Zusammenspiel mit den anderen Aspekten zu einer einfach anzuwenden Gewohnheit wird. Dazu kommen, dass zum einen regelmäßige Bewegung den Dopaminspiegel reguliert und damit die gleiche neurobiologische Grundlage beeinflussen, auf die auch Ernährung wirkt (Döpfner, 2021), zum anderen die Regenerations- und Vorbereitungsphasen beim Sport stark durch Ernährung beeinflusst werden können

Gesunde Ernährung bei ADHS ist somit kein isoliertes Ziel, sondern ein fortlaufender Prozess aus Planung, Bewusstsein und Selbstfürsorge. Kleine, konsequente Schritte – wie das Vorbereiten einer Mahlzeit oder das Etablieren fester Essenszeiten – können langfristig den entscheidenden Unterschied machen, um zielsicher anzukommen.
Fazit
Dass ein gesunder Lebensstil mit vielen positiven Nebeneffekten verbunden ist, ist unlängst bekannt. Zudem ist es heute einfacher denn je, sich selbst jederzeit Rezepte rauszusuchen und/oder mit Zutaten nach Hause bestellen zu lassen und zu experimentieren. Eben diese Bequemlichkeit, sich die Dinge liefern zu lassen und nicht selbst einkaufen zu gehen, spiegelt sich auch im Essverhalten wider. Mehr und mehr proccessed foods oder andere behandelte Varianten finden sich nicht nur in Supermärkten, aber auch in diversen Imbissbuden. Die freie, unkomplizierte Zugänglichkeit zu diesen Varianten führt in vielen Fällen dazu, dass man doch lieber zu dieser Variante statt der gesünderen Alternative greift.
Eine Umstellung der Ernährung ist zwar allmächtiges Heilmittel gegen ADHS, das es magisch verstummen lässt, solange man nur einem gewissen Plan folgt – aber sie ist ein machtvoller Einflussfaktor, der das tägliche Wohlbefinden, die Konzentrationsfähigkeit und die emotionale Balance deutlich mitbestimmen kann. Während genetische und neurobiologische Grundlagen die Kernsymptome der Störung erklären (Döpfner, 2021), zeigen Forschung und klinische Erfahrung gleichermaßen, dass Umweltfaktoren – insbesondere Ernährung – entscheidend dazu beitragen können, wie stark diese Symptome im Alltag spürbar werden (Philipsen & Hesslinger, 2019).
Dabei gibt es eine Vielzahl an möglichen Ernährungsvarianten bzw. einzelnen Gerichten, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Allen gemein ist, dass diese reich an natürlichen, wenig verarbeiteten Lebensmitteln ist. Dies stabilisiert nicht nur den Blutzuckerspiegel, sondern auch die mentale Energie. Sie hilft, typische Schwankungen zwischen Überfokus und Erschöpfung abzufedern und unterstützt eine gleichmäßigere Aktivierung des Gehirns. Der Verzicht auf stark zuckerhaltige, farbstoffreiche und industriell verarbeitete Produkte kann dabei ebenso hilfreich sein wie das bewusste Einbauen gesunder Fette, Eiweiße und komplexer Kohlenhydrate (Block et. al., 2011).
Gerade bei ADHS geht es nicht um Perfektion, sondern um Konsistenz: kleine, realistische Schritte, die langfristig Wirkung zeigen. Dabei ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese mit durch Struktur und Vorbereitung entstehen. Meal-Prep, feste Essenszeiten und ein realistischer Wochenrhythmus können helfen, impulsives Essverhalten zu verringern und eine stabile Ernährungsroutine zu etablieren. Diese Routinen wirken sich nicht nur auf das Essverhalten aus, sondern fördern insgesamt Selbstregulation, Planungsfähigkeit und psychische Stabilität – zentrale Themen bei ADHS (Döpfner & Lehmkuhl, 2015).
Begreift man Ernährung als Teil des Selbstmanagements und implementiert dies als feste Routine in den Tages- und Arbeitsalltag, kann eine weitere Säule zur Schaffung einer stabilen Grundlage geschaffen werden. Letztlich geht es dabei nicht um Perfektion, sondern um das eigene Wohlbefinden und die Balance. Wie so oft, entscheidet die Dosis.

Quellen
There Arnold, L. E., Lofthouse, N., & Hurt, E. (2012). Artificial food colors and attention-deficit/hyperactivity symptoms: a review of the clinical and experimental evidence. Neurotherapeutics, 9(3), 753–761. doi:10.1007/s13311-012-0135-8
Bloch, M. H., & Qawasmi, A. (2011). Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 50(10), 991–1000. doi:10.1016/j.jaac.2011.06.008 PubMed
Barkley, R. A. (2014). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment (4th ed.). Guilford Press
Döpfner, M. (2021). ADHS – Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Grundlagen, Diagnostik und Therapie (3., vollständig überarb. Aufl.). Hogrefe
Döpfner, M. (2022). Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP) (6., überarb. Aufl.). Hogrefe
Döpfner, M., & Lehmkuhl, G. (2015). Kinder- und Jugendpsychiatrie: Lehrbuch und Praxisleitfaden (2. Aufl.). Springer
Ferreira, R. C., et al. (2024). Early ultra-processed foods consumption and hyperactivity/inattention in adolescence: longitudinal evidence. International Journal of Epidemiology / BMC Public Health (2024). Retrieved from PubMed Central
Lange, K. W., Lange, K. M., Nakamura, Y., & Reissmann, A. (2023). Nutrition in the management of ADHD: A review of recent research. Current Nutrition Reports, 12(3), 383–394. https://doi.org/10.1007/s13668-023-00487-8
Müller, U., & Hesslinger, B. (2020). ADHS im Erwachsenenalter – Ein neurobiologisches Konzept und seine therapeutischen Konsequenzen. Schattauer
Nigg, J. T., Lewis, K., Edinger, T., & Falk, M. (2012). Meta-analysis of attention-deficit/hyperactivity disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms, restriction diet, and synthetic food color additives. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(1), 86–97.e8. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2011.10.015
Philipsen, A., & Hesslinger, B. (2019). ADHS im Erwachsenenalter: Symptome, Diagnostik und Therapie (4. Aufl.). Kohlhammer
There Arnold, L. E., Lofthouse, N., & Hurt, E. (2012). Artificial food colors and attention-deficit/hyperactivity symptoms: a review of the clinical and experimental evidence. Neurotherapeutics, 9(3), 753–761. doi:10.1007/s13311-012-0135-8

Schreibe einen Kommentar