Kürzlich entstand während des Verfassens eines meiner PhD Papers eine angeregte Diskussion mit einer Freundin, die ihren Titel bereits hatte. Ich bemerkte, dass sie mich bereits eine Zeit lang beobachtet hatte, konnte aber nicht den genauen Grund dessen benennen. Auf Nachfrage erklärte sie dann, dass sie seit einiger Zeit folgende Beobachtung gemacht hat: Allgemein sei ich sehr vorausschauend und mit Planung an den PhD, die Thematik und Abfolge der Papers gegangen und hätte thematisch gut nachgeschärft, wo es nötig war. Gleichzeitig sehe ich manchmal aber den „Wald vor lauter Bäumen“ nicht, im Sinne, dass ich zwar für das große Ganze einen Plan habe, mich selbst allerdings bei den kleinen Schritten für die einzelnen Paper oftmals verliere.
Aus der eigenen Beobachtung und Anekdoten von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es für viele Berufstätige, aber auch Studenten, mit ADHS oftmals schwierig, Umsetzung eigener Ziele so zu gestalten, dass sie (a) realistisch, (b) innerhalb eines zeitlichen Rahmens (c) planmäßig umzusetzen sind. Dies mag für viele Aufgaben nach einer leicht zu handelbaren Vorgehensweise erscheinen, kann für Menschen mit ADHS oftmals aber eine besondere Herausforderung darstellen. Häufig ist die Vision des Endergebnisses klar vor Augen – etwa ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt, das Verfassen eines Proposals für eine Projektakquise oder eine gute Note für die Abschlussarbeit – doch der Weg dorthin bleibt diffus und schwer kleinteilig strukturiert.
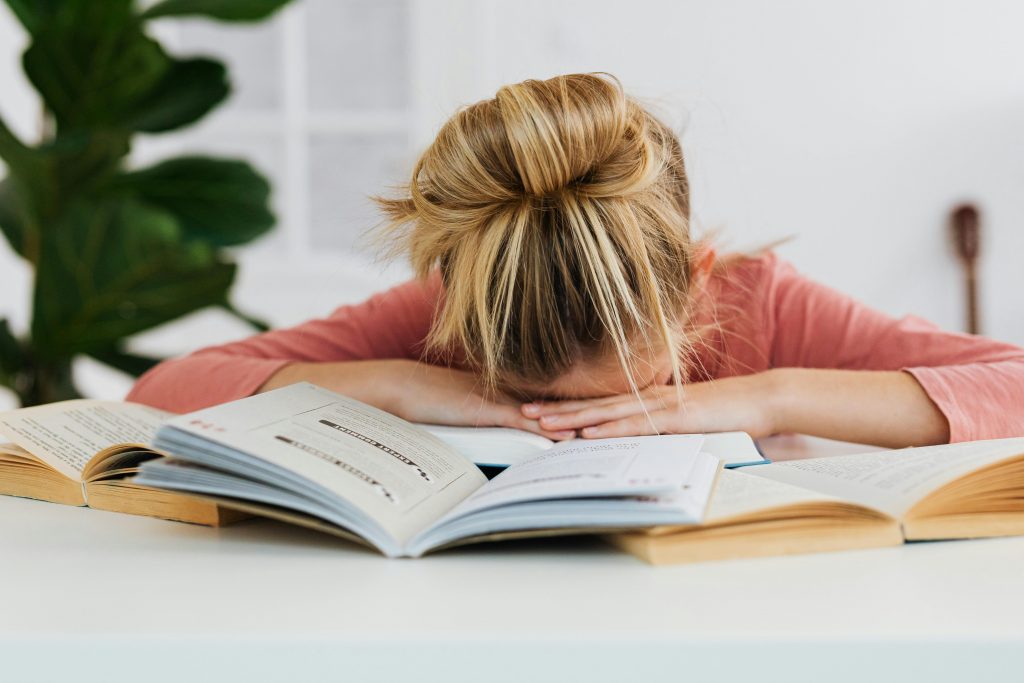
Barkley beschrieb diese Diskrepanz in vielen seiner Arbeiten, die Diskrepanz zwischen Zielklarheit und Umsetzungsfähigkeit, die eng mit den bei ADHS typischen Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen zusammenhängen. Nach Barkley (2012) sind vor allem das Zeitmanagement, die Handlungsplanung und die Fähigkeit, Aufgaben in realistische Teilschritte zu zerlegen beeinflusst. Das heißt nicht, dass grundsätzlich jedes Vorhaben bzw. jede Aufgabe dem Ausmisten des Augiasstall gleichkommen (!), allerdings sind manche mit deutlich größeren Schwierigkeiten verbunden. In der Folge können ohne geeignete Strategien häufig Überforderung, Prokrastination oder das Gefühl, sich in Nebensächlichkeiten zu verzetteln auftreten, was die Motivation und damit das Erreichen der gesteckten Ziele zusätzlich beeinträchtigt.
Gerade in Übergangsphasen – etwa beim Wechsel vom Studium zum Jobeinstieg oder nach der Beförderung und neuen Kosmos an Aufgaben und Verantwortlichkeiten – können diese Schwierigkeiten verstärkt auftreten. Studierende und junge Berufseinsteiger sind in hohem Maße gefordert, ihren Alltag eigenverantwortlich zu organisieren, Prioritäten zu setzen und langfristig an Projekten zu arbeiten (Kofler et al., 2019). Für Menschen mit ADHS bedeutet dies, dass sie Methoden brauchen, die es ihnen ermöglichen, große Vorhaben in überschaubare Handlungsschritte zu untergliedern und dabei kontinuierlich Fortschritt zu erleben.
Der entscheidende Vorteil dessen ist: Indem komplexe Ziele in Teilaufgaben zerlegt und klare Zwischenziele definiert werden, lassen sich, so Barkley, Motivation und Selbstwirksamkeit stärken (Barkley, 2015). Gleichzeitig helfen strukturierte Routinen und externe Hilfsmittel – wie Checklisten, visuelle Planer oder digitale Reminder – dabei, den Überblick zu behalten und Ablenkungen zu reduzieren (Weyandt & DuPaul, 2013). Nachfolgend sollen hierzu praxistaugliche Strategien aufgezeigt werden, die es ermöglichen, mit ADHS langfristige Vorhaben erfolgreich und ohne Verzettelung umzusetzen.
Das gedankliche Dickicht lichten
Ein zentrales Problem für Studenten und Berufstätige mit ADHS besteht darin, dass das Setzen und Verfolgen von Zielen durch eine hohe Ablenkungsanfälligkeit und Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen erheblich beeinträchtigt wird. Typischerweise zeigt sich dieses Problem in Situationen, in denen längerfristige Projekte ohne klare Zwischenziele bewältigt werden müssen, etwa beim Verfassen einer Seminararbeit oder beim Erstellen eines beruflichen Marketingkonzepts. Betroffene berichten häufig, dass sie zu Beginn einer Aufgabe zwar eine Vorstellung des Endprodukts haben, jedoch Schwierigkeiten erleben, den ersten Schritt zu identifizieren und konsequent umzusetzen (Barkley, 2012). Kommen Ablenkungen hinzu – beispielsweise digitale Benachrichtigungen oder spontane Tätigkeiten – fällt es vielen schwer, nach einer Unterbrechung an den Ausgangspunkt zurückzukehren. Dies führt nicht selten zu einem Muster aus häufigen Neuanfängen, Unterbrechungen und einem Gefühl mangelnder Selbstwirksamkeit (Brown, 2005). Die Folge ist ein hoher kognitiver und emotionaler Stress, der die langfristige Zielverfolgung und persönliche Weiterentwicklung erschwert.

Wo stehe ich? Wo will ich hin?
Um diese Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, stattdessen anhand eines methodischen Ansatzes konkrete Prinzipien in den Alltag zu implementieren. Als möglicher Startpunkt empfiehlt sich hierbei mit einer klaren Problemanalyse zu beginnen. In einem ersten Schritt wird dabei der IST-Zustand betrachtet, dem die Frage zugrunde liegt: was ist das eigentliche Problem? Dieses kann anhand verschiedener Überlegungen herausgearbeitet werden: Wie oft gelingt es, eine Aufgabe ohne Unterbrechung für 20–30 Minuten zu bearbeiten? Wie häufig weicht man auf andere Tätigkeiten aus? Welche äußeren oder inneren Reize sind die typischen Auslöser für Unterbrechungen? Anhand einer reflektiven Betrachtung dieser Fragen, kann das Bewusstsein für das eigene, individuelle Ablenkungsprofil geschärft werden (Barkley, 2015).
Im nächsten Schritt wird der SOLL-Zustand definiert: Welche konkreten Ergebnisse sollen am Ende eines Tages, einer Woche oder eines Projekts stehen? Wie sieht eine geordnete, konzentrierte und strukturierte Vorbereitung bzw. Arbeit für dieses aus? Zur leichteren persönlichen Einordnung können diese anhand der SMART-Methode (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) (Locke & Latham, 2002) definiert werden.
Statt weitgehend verschwommener Zielformulierungen wie „Ich will an meiner Hausarbeit arbeiten“ oder „ich will mehr am Marketingentwurf arbeiten“ wären mögliche Zielformulierungen nach der SMART-Methode: „Bis Freitag habe ich zwei Kapitelentwürfe mit jeweils mindestens 500 Wörtern geschrieben.“, „ich werde an fünf Tagen pro Woche je zwei Blöcke von 25 Minuten fokussiert an einer klar benannten Aufgabe arbeiten, die ich in der Woche zuvor definiert habe“. Oder zufällige Ausschnitte im Rahmen des beruflichen Kontexts: „Bis Ende Woche 1 soll eine Marktanalyse (mindestens 3 Hauptkonkurrenten) abgeschlossen sein, die ich meinem Kollegen XYZ zeigen kann“, „Bis Ende Woche 3 sollen Konzeptideen klar skizziert, und intern vorgestellt werden“ und „Bis Ende Woche 6 liegt das finale Marketingkonzept mit Budgetplan und Präsentation für die Geschäftsführung vor“. Jedes dieser Ziel wird dann in kleinere, überschaubare Aufgaben aufgeteilt, z.B. Daten recherchieren über A, B, C → Analysegrafiken erstellen mit Powerpoint und PowerBI→ erste Konzeptskizzen anfertigen mit Word und Canvas.
Feste Zeiten, feste Rhythmen etablieren
Zusätzlich werden für diese Aufgaben feste Zeitintervalle eingeplant und geblockt, die kurze Arbeitsintervalle gemäß der Pomodoro-Technik unterstützen (Cirillo, 2006). Dabei sollte man sich selbst immer wieder sog. Implementation Intentions („Wenn es 10:00 Uhr ist, dann starte ich die Analyse und öffne nur die relevanten Dateien“) helfen, den Arbeitsbeginn zu automatisieren und Ablenkungen und Entscheidungslast zu minimieren (Gollwitzer, 1999).

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Stimulus-Kontrolle, da ADHS-Betroffene besonders stark auf äußere Reize reagieren (Sonuga-Barke, 2005). Praktische Maßnahmen wie das Entfernen des Smartphones aus dem Sichtfeld, das Nutzen von Browser-Blockern oder das Arbeiten mit nur einem geöffneten Dokument können hier einen entscheidenden Unterschied machen.
Den Frosch essen, statt ihn zu küssen
Ein weiterer hilfreicher Ansatz ist das Konzept „Eat the Frog First“, das auf Mark Twain zurückgeführt und von Brian Tracy (2001) popularisiert wurde. Gemeint ist, dass die wichtigste, oft aber auch unangenehmste oder kognitiv anspruchsvollste Aufgabe gleich zu Beginn des Tages erledigt werden sollte. Was oftmals vielen Menschen schwer fällt, und besonders markant bei ADHS ist, nämlich, dass man bestimmte Aufgaben soweit wie möglich aufschiebt, da sie nicht das ersehnte Dopaminfeuerwerk auslösen. Allerdings bietet es gerade für Menschen mit ADHS einen entscheidenden Vorteil, da schwierige Aufgaben nicht aufgeschoben, sondern in einer Phase bearbeitet werden, in der Energie und Konzentration noch am höchsten sind. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von Prokrastination und verhindert, dass wesentliche Arbeit durch weniger wichtige, aber leichter zu bewältigende Tätigkeiten verdrängt wird (Barkley, 2012). In Kombination mit Time-Blocking und kurzen Fokusintervallen lässt sich das Prinzip direkt in die Tagesstruktur integrieren: Zu Arbeitsbeginn wird ein Block für die „Frosch-Aufgabe“ reserviert, der durch eine klare Wenn–Dann-Regel und ein festgelegtes Ende (z. B. nach 25–30 Minuten) strukturiert wird. Auf diese Weise lassen sich zum einen nicht nur die schwierigsten Hindernisse überwinden, zum anderen lässt sich zugleich ein starkes Gefühl von Fortschritt und Selbstwirksamkeit bereits früh am Tag aufbauen – ein (weiterer psychologischer) Verstärker, der die Motivation für die folgenden Aufgaben erhöht (Gollwitzer, 1999; Sonuga-Barke, 2005).
Abschließend sei nochmals betont, dass Menschen mit ADHS zugleich deutlich mehr als andere von Externalisierung profitieren. Daher sollte es innerhalb eines geeigneten Rahmens so weit wie möglich praktiziert werden. Dazu zählen u.a. Checklisten, damit keine Aufgaben übersehen werden und visuelle Fortschrittsanzeigen, die die Motivation erhöhen sollen, z.B. durch ein Kanban-Board mit Spalten „To Do“, „In Arbeit“ und „Erledigt“ (Barkley, 2015). Alles, was irgendwie den geistigen Arbeitsspeicher „entlasten“ kann und dafür sorgt, dass man sich voll und ganz auf die eigentlichen Aufgaben fokussiert, hilft.
Fazit
Abschließend lässt sich betonen, dass eine erfolgreiche Zielverfolgung, unabhängig von der eigenen Lebenssituation, mit ADHS weniger in spontaner Motivation oder purer Willenskraft begründet liegt, sondern vielmehr in der Etablierung strukturierter Rahmenbedingungen, die die Schwächen der exekutiven Funktionen systematisch ausgleichen. Wesentlich ist es, große Vorhaben in kleine, klar definierte Handlungsschritte zu zerlegen, diese mit messbaren Kriterien zu versehen und sie konsequent in den Tages- und Wochenablauf einzubinden. Instrumente wie Time-Blocking, kurze Fokusintervalle und das bewusste Sichtbarmachen von Fortschritt schaffen dabei Orientierung und reduzieren die Gefahr des Verzettelns und das Aufgaben auf der Strecke liegen bleiben. In Verbindung mit Wenn–Dann-Plänen, regelmäßigen Feedbackschleifen und unmittelbaren Belohnungen entsteht relativ einfach ein praxisnahes System, das nicht nur die Zielerreichung wahrscheinlicher macht, sondern zugleich mehr eigenständige Kontrolle bietet und Selbstwirksamkeit stärkt. Damit wird Zielverfolgung zu einem planbaren Prozess, der es ermöglicht, trotz ADHS kontinuierlich voranzukommen und langfristige Projekte erfolgreich zu bewältigen (Barkley, 2012; Gollwitzer, 1999; Locke & Latham, 2002). Nachfolgend sind die Kernprinzipien zum Kopieren zusammengefasst:
Kernprinzipien — kurz und handlungsorientiert
- Klare nächste Aktion: Formuliere eine einzige konkrete nächste Aufgabe (z. B. „Einleitung mit 250 Wörtern bis 9:25 Uhr schreiben“) — nicht „an einem Kapitel arbeiten“
- Externe Startregel (Wenn–Dann): Verbindliche Startbedingung: „Wenn 9:00 Uhr ist, dann setze ich den Timer auf 25 Min und schreibe 250 Wörter.“ (Gollwitzer, 1999).
- Stimulus- und Umgebungskontrolle: Aktives entfernen von Ablenkungen (Handy außer Sicht, Tabs geschlossen, Benachrichtigungen aus etc.), um den Fokus nicht zu brechen und die Willenskraft zu erhalten
- Eat the frog first: die unangenehmen Aufgaben zuerst erledigen, um den Schwung des Erfolgs und der vorhandenen Konzentration voll zu nutzen (Brian Tracy, 2001)
- Fokussierte Zeitfenster + kurze Intervalle: Time-Blocking kombiniert mit kurzen Fokusintervallen gemäß Pomodoro-Technik (25/5 oder 15/5 je nach Energieprofil), ggf. bei ADHS kürzere Intervalle effektiver (Cirillo, 2006)
- Sichtbarer Fortschritt & Belohnung: Jede erledigte kleine Aufgabe sofort abhaken + kleine, zeitnahe Belohnung einplanen (Sonuga-Barke, 2005)
- Externe Verbindlichkeit: Regelmäßige kurze Check-Ins mit Peers/Mentor erhöhen die Durchhaltequote (Locke & Latham, 2002), während positives Feedback die Motivation erhält

Quellen
- Barkley, R. A. (1997). ADHD and the nature of self-control. New York, NY: Guilford Press
- Barkley, R. A. (2012). Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved. New York, NY: Guilford Press
- Barkley, R. A. (2015). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (4. Aufl.). New York, NY: Guilford Press
- Brown, T. E. (2005). Attention deficit disorder: The unfocused mind in children and adults. New Haven, CT: Yale University Press
- Cirillo, F. (2006). The Pomodoro Technique [Selbstveröffentlichung].
- Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493–503. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493
- Kofler, M. J., Rapport, M. D., Bolden, J., Sarver, D. E., Raiker, J. S., & Alderson, R. M. (2019). Working memory deficits and social problems in children with ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(4), 593–606. https://doi.org/10.1007/s10802-018-0471-0
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705–717. https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705
- Sonuga-Barke, E. J. S. (2005). Causal models of attention-deficit/hyperactivity disorder: From common simple deficits to multiple developmental pathways. Biological Psychiatry, 57(11), 1231–1238. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.09.008
- Tracy, B. (2001). Eat that frog! 21 great ways to stop procrastinating and get more done in less time. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers
- Weyandt, L. L., & DuPaul, G. J. (2013). College Students with ADHD: Current Issues and Future Directions. New York: Springer

Schreibe einen Kommentar