Die Ferienzeit gilt für viele als willkommene Auszeit – eine Gelegenheit zum Entspannen, zum Reisen oder einfach zum Ausschlafen. Doch gerade für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) kann diese Phase der strukturellen Freiheit zur Herausforderung werden. Während Schule, Studium oder Arbeit durch klare Zeitvorgaben, Routinen und externe Erwartungen häufig als „stabilisierender Rahmen“ wirken, brechen diese Strukturen in den Ferien oft vollständig weg – mit potenziell negativen Folgen für Konzentration, Tagesrhythmus, emotionale Regulation und Motivation.
Zahlreiche Studien belegen, dass Menschen mit ADHS in besonderem Maße von festen Routinen profitieren, um exekutive Funktionen zu entlasten und Selbstregulation zu fördern (Barkley, 2011; Kofler et al., 2018). Ohne die typischen äußeren Ankerpunkte neigen Betroffene in strukturfreien Zeiten stärker zu Reizüberflutung, Prokrastination und dysregulierten Schlaf-Wach-Zyklen (Shaw et al., 2012). Auch in der klinischen Praxis wird immer wieder beobachtet, dass Ferienzeiten mit einem kurzfristigen Rückgang der funktionalen Alltagsbewältigung einhergehen – insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Wehmeier et al., 2009).
Doch wie lässt sich in der ferienbedingten Freiheit eine hilfreiche Form von Struktur aufrechterhalten – ohne dabei den Erholungswert zu verlieren? In diesem Beitrag wollen wir wissenschaftlich fundierte Strategien vorstellen, wie Menschen mit ADHS ihre individuelle Alltagsstruktur auch in den Ferien bewusst gestalten können. Dabei geht es nicht um rigide Zeitpläne, sondern um flexible Ankerpunkte, Routinen und mikrostrukturierende Elemente, die Selbstwirksamkeit und innere Stabilität fördern.

Während der regulären Vorlesungs- oder Arbeitszeit helfen äußere Strukturen wie Stundenpläne, Meetings oder Deadlines oft unbewusst dabei, den Tag zu gliedern. Da man weiß, bis wann etwas erledigt sein muss, hat man zwar einen ersten Ankerpunkt, der allein aber nicht ausreicht. Vor allem nicht, wenn man die „Zeitblindheit“, mit ADHS einhergeht, berücksichtigt. Während der Ferienzeit entfällt (teilweise) die „Fremdstrukturierung“ – und damit ein entscheidender Anker weg. Um diesem vorzubeugen, hilft es, sogenannte Mikro-Routinen, d.h. kurze, klar umrissene Abläufe wie z. B. eine feste Morgenroutine (z. B. aufstehen, duschen, kurzes Journaling, Frühstück) oder eine Abendroutine (z. B. Handy weglegen, lesen, Schlafenszeit) zu implementieren. Selbst wenn äußere Rahmenbedingungen sich verändern bzw. abschwächen, entfalten diese kleinen Rituale eine Stärkung der exekutiven Funktionen und eine stabilisierende Wirkung der Stimmung und Motivation (Tamm et al., 2012; Robin & Sprich, 2009).
Im Nachfolgenden sollen ein paar Beispiele hierfür vorgestellt werden:
1. Tagesstruktur visualisieren: Der Plan als Kompass
Da es Menschen mit ADHS oft schwerfällt, Zeit abstrakt zu erfassen und zu nutzen (Barkley, 2011), hilft es, drei unterstützende Säulen zu etablieren: Ankerpunkte für den Tag, fixe Zeitpunkte- und Räume für bestimmte Aktivitäten und (visuelle) Pläne. Das bedeutet, dass z.B. regelmäßige Routinen für bestimmte Aktivitäten eingeplant werden: nachdem Morgenkaffee und Austausch mit Kollegen, arbeite ich für 2 Stunden am Projekt ABC. Statt einer direkten zeitlichen Fixierung wird auf eine „event-based time management“ Methode (Safren et al., 2005) gesetzt. Vielen Menschen mit ADHS helfen diese fließenden Übergänge beim Wechsel der Tätigkeiten. Die vorab definierten Zeiträume sollten trotzdem nicht zu weit eingerissen werden, damit immer klar ist, was wann wo erledigt sein sollte. Stark unterstützend wirken dabei visuellen Reize (und klaren Abläufen) (Brown, 2006). Eine einfache, aber wirksame Methode ist daher, sich einen Tages- und Wochenplan zu erstellen, der farblich codiert und gut sichtbar allzeit zugänglich ist. Ob analog mit Stift und Papier oder digital über Apps wie „Structured“ oder „TimeBloc“. Allerdings sind diese auch nur so gut, wie sie regelmäßig genutzt und die klaren Ankerpunkte als Ausgangsbasis , die für den gesamten Tagesverlauf stabilisierend wirken (Barkley, 2011), genutzt werden.
2. „Kleinschrittigkeit“ statt Perfektion: Machbare Ziele setzen
Ein typischer Stolperstein für viele Menschen mit ADHS ist der Wunsch, gleich alles perfekt zu strukturieren und erledigen – was oft in Überforderung endet und Chaos endet. Sobald ein Fehler aufkommt oder das gewünschte Ideal nicht erreicht wird, schlägt das altbekannte „Alles-oder-Nichts“-Denken voll durch: Scheitert ein Element des Plans, wird oft der gesamte Tagesablauf als „gescheitert“ empfunden (Knouse, Zvorsky & Safren, 2013).
Solche Erfahrungen können intensive emotionale Reaktionen auslösen – von Frustration über Schuldgefühle bis hin zu kompletter Vermeidung. Bereits kleinere Abweichungen von Erwartungen können aufgrund der emotionalen Dysregulation bei ADHS starke Affektausbrüche begünstigen können, die für Außenstehende in keinerlei Verhältnis stehen, im Gegenteil sogar (Shaw et al., 2014). Gerade in strukturarmen Zeiten wie den Ferien fehlen oft die „emotionalen Puffer“ durch Routinen, soziale Rückmeldung oder externe Zielvorgaben, an denen sich orientiert und kleine (konsekutive) Erfolgserlebnisse aufgebaut werden können.
Um dieser Dynamik entgegenzuwirken, hat sich ein kleinschrittiger Planungsansatz bewährt: Statt sich mit einem überambitionierten Tagesziel selbst unter Druck zu setzen, ist es effektiver, maximal drei realistische, gut erreichbare Aufgaben für den Tag zu definieren – möglichst konkret, einfach durchführbar und mit sichtbarem Erfolgserlebnis. Dieser Ansatz basiert auf Erkenntnissen aus der verhaltenstherapeutischen ADHS-Behandlung, wonach positive Verstärkung durch schnelle Erfolgserlebnisse die Selbstregulation deutlich verbessert (Safren et al., 2005; Ramsay & Rostain, 2016).
Zudem unterstützt dieser Planungsstil die dopaminerge Belohnungsverarbeitung, die bei Menschen mit ADHS häufig unteraktiv ist (Volkow et al., 2009). Wenn Aufgaben in kleine, bewältigbare Schritte unterteilt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gehirn ein „Erfolgssignal“ ausschüttet – was wiederum zu höherer Motivation und mehr Ausdauer bei künftigen Aufgaben führt (Antshel & Barkley, 2020).
Ein praktischer Merksatz für den Alltag kann zum Beispiel dienen:
„Lieber drei kleine Dinge gut machen, als an einem großen Anspruch scheitern.
Beispiel: Statt „heute das gesamte Proposal fertigzustellen“ lieber: „heute drei Kernpunkte ausformulieren“.
3. Zeitinseln für Bewegung, Fokus und Pause
Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, profitieren Menschen mit ADHS besonders von alltagstauglicher Struktur, die nicht rigide, sondern anpassbar ist. Strikte Zeitpläne mit festen Uhrzeiten scheitern in der Realität oft an der fehlenden Zeitwahrnehmung und Selbstregulation (Barkley, 2011). Gleichzeitig führt fehlende Struktur schnell zu Chaos, Reizüberflutung oder Entscheidungslähmung – beides nicht optimale Voraussetzungen zur Alltagsbewältigung. Um dies zu umgehen, liegt die Lösung in einem dynamischen dreiteiligen System aus, die sich gegenseitig ergänzen:
1. Mikro-Routinen – stabilisierende Übergänge schaffen
Mikro-Routinen sind kurze, wiederkehrende Abläufe, z. B. eine feste Morgenabfolge (aufstehen – duschen – frühstücken – 10 Minuten Journaling). Diese Routinen helfen dabei, Handlungsketten automatisiert ablaufen zu lassen und die kognitive Belastung zu reduzieren. Studien zeigen, dass regelmäßige Gewohnheiten die Belastung der exekutiven Funktionen verringern, da weniger bewusste Planung nötig ist (Tamm et al., 2012; Robin & Sprich, 2009), was insbesondere Menschen mit ADHS zugute kommt.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt von Mikro-Routinen ist ihr Effekt als emotionale Puffer: Wenn der Rest des Tages unvorhersehbar verläuft, schaffen diese festen Elemente ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit – ein wichtiger Schutzfaktor gegen emotionale Dysregulation (Shaw et al., 2014). Selbst unvorhergesehene Änderungen lassen sich im Zweifel abfedern.
2. Zeitanker – Orientierung statt starre Uhrzeiten
Wie bereits oben und in anderen Posts erwähnt, geht ADHS häufig mit einer gestörten Zeitverarbeitung einher: Zeit allgemein wird schlecht „gefühlt“ und zukünftige Ereignisse schwer als relevant eingeschätzt bzw. im zeitlichen Horizont greifbar (Barkley et al., 2001). Daher sollte nicht mit festen Uhrzeiten sondern mit Ereignis-basierten Ankern geplant werden: „Nach dem Frühstück“, „nach der Mittagspause“, „vor dem Abendessen“. Diese kontextgebundene Planung nutzt natürliche Übergänge im Alltag, die das Gehirn leichter verarbeiten kann (Safren et al., 2005), wodurch der Tag an Rhythmus gewinnt, ohne rigide zu wirken.
3. Zeitinseln – modulare Tagesbausteine für Fokus, Bewegung und Pause
Zwischen den ersten beiden Bausteinen, Mikro-Routinen und Zeitankern, fügen sich Zeitinseln ein: klar abgegrenzte, bewusste Phasen für bestimmte Funktionsbereiche – etwa Fokusblöcke (25 Minuten konzentrierte Arbeit mit Pomodoro-Technik), Bewegungszeiten (z. B. 20 Minuten Fahrradfahren) oder Pauseninseln (z. B. Gang in die Kaffeeküche oder bewusstes Nichtstun). Studien zeigen, dass diese Art modularer Tagesstruktur die Selbstwirksamkeit erhöht, da sie überschaubar, realistisch und kurzfristig belohnend ist (Knouse & Safren, 2010; Ramsay & Rostain, 2016).
Bewegungsinseln wirken dabei sogar direkt auf die neurobiologischen Grundlagen von ADHS: Akute körperliche Aktivität verbessert die Aufmerksamkeit, reduziert Hyperaktivität und stärkt exekutive Funktionen und strukturierte Selbstführung (Gapin & Etnier, 2010; Pontifex et al., 2013). Auch Fokusphasen mit klarer Begrenzung helfen nachweislich, die sogenannte „Task Initiation“ – also den Einstieg in eine Aufgabe – zu erleichtern, was bei ADHS eine häufige Hürde darstellt (Sibley et al., 2016).

Die Forschung betont immer wieder: Flexible, aber wiedererkennbare Strukturen sind der Schlüssel zu gelingender Selbstorganisation bei ADHS – insbesondere in Phasen ohne äußere Vorgaben (Antshel & Barkley, 2020; Ramsay & Rostain, 2016). Dieses Zusammenspiel aus Mikro, Anker und Inseln schafft genau das: ein anpassbares System, das Orientierung gibt, ohne zu überfordern.
Pausen, die in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt worden sind, sollen dabei nicht als „Nichtstun“ oder Phasen des „Stehenbleibens“ verstanden werden. Im Gegenteil, sie sind ein aktiver Teil des Tagesplans, der vor allem häufig vorkommendes „Vermeidungsverhalten“ (z.B. in Social Media flüchten, sich dort in digitaler Reizüberflutung verlieren, was wiederum dazu führt, dass sowohl die Konzentration als auch der spätere Schlaf negativ beeinflusst werden (Becker et al., 2018). Stattdessen sollte für diese Phasen eine erholsame, aber bewusste Aktivität eingeplant werden (z.B. eine Tasse Kaffee machen, ein kurzer Spaziergang, Achtsamkeitsübungen).
4. Verlässliche soziale und digitale Anker: Struktur durch Verbundenheit und Technik
Während Mikro-Routinen, Zeitinseln und Ankerpunkte eine solide Grundstruktur im Alltag schaffen, können soziale und digitale Elemente als zusätzliches äußeres Strukturelement und Verbindlichkeit dienen – besonders dann, wenn Eigenmotivation und Selbstregulation ins Wanken geraten. Barkley hat in diversen Arbeiten gezeigt, dass Menschen mit ADHS sehr stark von äußeren Reizen profitieren, die sie an geplante Handlungen erinnern oder sie in soziale Kontexte einbinden (Barkley, 2011). In der Ferienzeit, in der viele natürliche soziale Strukturen (z. B. Schulbesuch, Kollegenkontakt) wegfallen, ist es daher besonders sinnvoll, bewusst soziale und digitale Ankerpunkte zu setzen. Dies kann z.B. durch regelmäßigen Austausch, gemeinsame Aktivitäten mit Freunden oder Familienmitgliedern hergestellt werden.
1. Soziale Anker – Verbindung als Strukturgeber
Regelmäßiger sozialer Austausch – sei es mit Freunden, Familie oder Arbeitskollegen – ist weit mehr als nur eine emotionale Unterstützung: Die soziale Natur des Menschen fördert und fordert diesen regelmäßigen sozialen Austausch, wodurch sich eine strukturierte Routine entwickeln kann, da andernfalls gemeinsame Aktivitäten, feste Verabredungen oder Gespräche nicht stattfinden würden bzw. sich die Personen mit der Zeit distanzieren würden, da man sich selbst nicht an Vereinbarungen hält. Sofern es fix verankerte Zeiten für diese sozialen Interaktionen gibt, können sie ebenfalls dabei helfen, den Tag oder die Woche zu gliedern und fungieren als Verstärker von Motivation und Verbindlichkeit. Denn, wer sich etwa einmal pro Woche mit einem Freund zum Sport verabredet oder gemeinsam mit anderen an einem Projekt arbeitet, entwickelt mehr Durchhaltevermögen – auch aufgrund des psychologischen Phänomens der sozialen Erwartung und Gegenseitigkeit (Ryan & Deci, 2000).
Ähnlich wie das Mentoring-Prinzip, das bereits in vielen Unternehmen ein fixer Bestandsteil ist, hat sich in der ADHS-Therapiepraxis das sogenannte „Body Doubling“ bewährt: Angelehnt an das Konzept der sozialen Erwartung und Gegenseitigkeit arbeiten zwei Person – egal, ob physisch anwesend oder virtuell zugeschaltet – zur selben Zeit an einer eigenen Aufgabe. Bereits die Anwesenheit einer anderen Person, unabhängig vom Level der Kommunikation, steigert nachweislich die Aufmerksamkeitsdauer und reduziert Ablenkbarkeit, weil eine subtile Form sozialer Kontrolle entsteht (Brown, 2006; Ramsay & Rostain, 2016).
2. Digitale Anker – Technische Helfer zur Selbststrukturierung
Manchen fällt es schwerer, sich regelmäßig sozial mit anderen auszutauschen bzw. an Veranstaltungen teilzunehmen. Wobei die Gründe hierfür vielfältig sein können. Heutzutage können digitale Tools eine ähnlich stabilisierende Funktion übernehmen (wobei diese keinen gleichwertigen Ersatz für echte zwischenmenschliche Beziehungen darstellen!). Erinnerungs-Apps, Kalender-Tools mit visueller Wochenansicht oder Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone wirken als externe Gedächtnisstützen – ein Prinzip, das auch als „external cueing“ bezeichnet wird (Tuckman, Abry, & Smith, 2002).
Besonders bewährt haben sich Tools mit Gamification-Elementen oder „Accountability-Funktionen“:
- Habitica verwandelt Gewohnheiten in ein Rollenspiel, das Nutzer durch tägliche Aufgaben, Belohnungen und Avatare motiviert.
- Beeminder bietet eine Art „Vertrag mit sich selbst“ – bei Nichterfüllung wird eine vorher definierte (auch monetäre) Konsequenz ausgelöst.
- Tools wie Focusmate ermöglichen virtuelle Body-Doubling-Sessions, bei denen man sich mit Fremden zu produktiven Zeitfenstern verabredet.
Diese Apps greifen Prinzipien auf, die in der kognitiven Verhaltenstherapie bei ADHS als besonders wirksam gelten: externe Struktur, sofortige Rückmeldung und Belohnung (Safren et al., 2005). Gerade in Phasen ohne äußere Verpflichtungen – wie während der Ferien – können solche Tools helfen, die Aufmerksamkeit zu bündeln und Ziele im Blick zu behalten (Basso et al., 2021).
5. Selbstmitgefühl als Gegengewicht zur Dysregulation
Vermutlich jeder Betroffene kennt es nur zu gut, dass Struktur und Zielorientierung ohne Frage zentrale (Alltags)Elemente im Umgang mit ADHS sind – besonders in strukturarmen Zeiten wie den Ferien. Doch ebenso wichtig ist das emotionale Gegengewicht: der bewusste, mitfühlende Umgang mit sich selbst, wenn Pläne scheitern, Energie fehlt oder der Tag „verlaufen“ ist. Für Menschen mit ADHS, die häufig unter emotionaler Dysregulation, Perfektionismus oder einem negativen inneren Kritiker leiden, ist Selbstmitgefühl nicht Luxus – sondern eine Schlüsselressource für psychische Stabilität (Shaw et al., 2014; Ramsay & Rostain, 2016).
1. Zwischen Erholung und Vermeidung unterscheiden
Jeder Mensch benötigt für sich Ruhephasen oder Zeiten, in denen er sich eine bewusste Auszeit gönnt. Manchen fällt dies leichter und sie hadern eher damit, nicht zu viele Pausen einzulegen, wohingegen viele Menschen mit ADHS jedoch mehr in einen inneren Konflikt geraten, wenn sie „nichts tun“: Schuldgefühle kommen auf („hätte ich damals nur…, ich begehe gerade den selben Fehler…“), Selbstkritik („nicht einmal für kurze Zeit kann ich mich ordentlich auf eine Aufgabe konzentrieren, ich kriege nichts hin…“), wird laut und das allzu vertraute Gefühl des (vermeintlichen) Versagens kommt wieder hoch (selbst wenn es objektiv gesehen ein Erfolg war, wird er von Menschen mit ADHS oft als unzureichend bzw. ungenügend empfunden, da man doch hätte mehr machen können, mehr erreichen können, sich selbst aber im Weg stand . Es baut sich stetig ein höherer Druck auf, ohne äußeren Zwang, der paradoxerweise die Wahrscheinlichkeit von Vermeidungsverhalten – also dem unbewussten Ausweichen vor Aufgaben durch zielloses Scrollen, Prokrastination oder Rückzug – erhöht. Ein praktikabler (und ebenbürtiger) Gegenspieler zu dieser Eskalationsspirale ist Selbstmitgefühl, also die Fähigkeit, sich in Momenten des Scheiterns oder der Enttäuschung mit Nachsicht statt mit Selbstkritik zu begegnen (Neff, 2003), d.h. als wohlwollender, akzeptierender Umgang mit eigenen Grenzen und Rückschlägen, ohne in Schuld oder Resignation zu verfallen (Neff, 2011; Sibley et al., 2022).
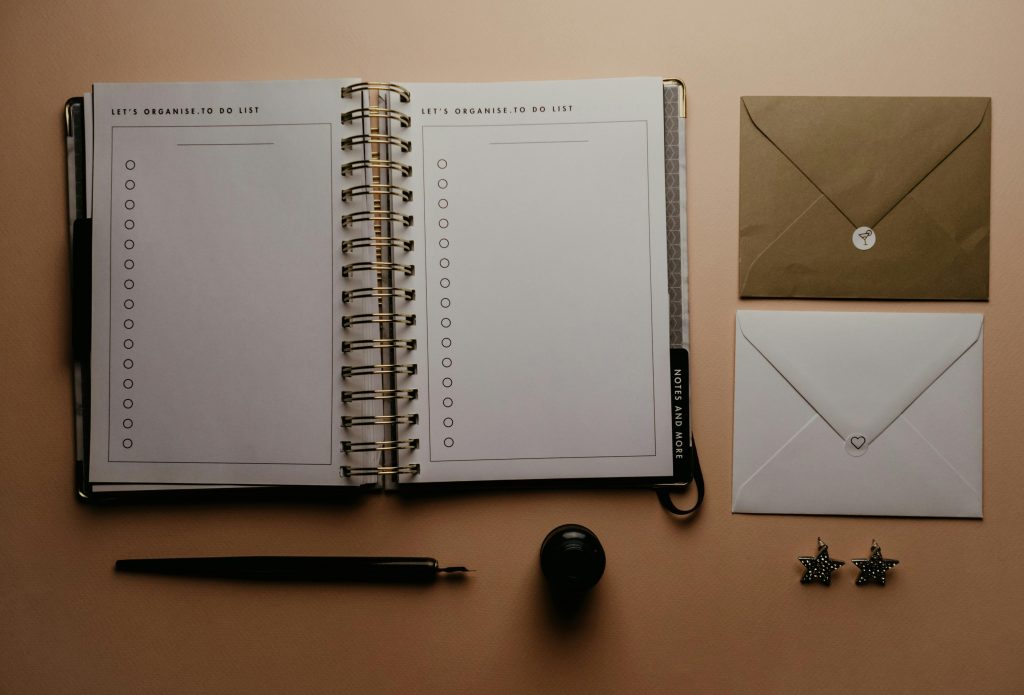
Zwischen Vermeidung und legitimer Pause unterscheiden
In der Ferienzeit besteht oft Unsicherheit darüber, ob eine Pause „verdient“ ist – oder nur eine Ausrede, um einer unangenehmen Aufgabe zu entgehen. Selbstmitgefühl hilft dabei, diesen Unterschied achtsam und ohne Urteil wahrzunehmen. Es ersetzt strenge innere Monologe („Du bist faul“) durch konstruktive Reflexion („Vielleicht brauche ich gerade wirklich eine Pause – oder ich habe Angst vor dem Anfang“).
Studien zeigen, dass Menschen mit ADHS dazu neigen, Überforderung mit Schuldgefühlen zu koppeln, was die kognitive Belastung zusätzlich erhöht (Sibley et al., 2022). Selbstmitgefühl kann diesen Teufelskreis unterbrechen und ermöglicht einen freundlicheren Umgang mit sich selbst – was paradoxerweise langfristig zu mehr Disziplin und Durchhaltevermögen führen kann (Neff & Germer, 2013; Owens et al., 2020).
2. Akzeptanz schafft Handlungsspielraum
Psychologische Interventionsmodelle wie ACT (Acceptance and Commitment Therapy) zeigen, dass Akzeptanz statt Kontrolle zu mehr Flexibilität und funktionalem Handeln führt – gerade bei neurodiversen Menschen (Hayes et al., 2006). Statt den inneren Widerstand zu bekämpfen („Ich darf nicht unproduktiv sein“), wird akzeptiert, dass Motivation schwankt – ohne dass dies den eigenen Selbstwert infrage stellt.
Diese Form der Selbstakzeptanz wird in aktuellen ADHS-Interventionen zunehmend betont, insbesondere für Erwachsene und Jugendliche, bei denen klassische disziplinfokussierte Modelle oft scheitern (Knouse et al., 2017; Sibley et al., 2022). Sie gilt als eine der wichtigsten Resilienzressourcen im Umgang mit ADHS in Phasen erhöhter Autonomie – wie der Ferienzeit.
Praktische Strategien zur Entwicklung von Selbstmitgefühl:
- Selbstgespräche bewusst gestalten: Statt „Ich krieg nichts hin“ → „Es war ein schwieriger Tag, aber ich darf es morgen wieder versuchen.“
- Achtsamkeit einüben: z. B. durch Journaling, Atemübungen oder Körperwahrnehmung – die eigene emotionale Selbstwahrnehmung fördern.
- Rückschläge einplanen: In jedem Wochenplan „Fehlertage“ oder „offene Fenster“ bewusst vorsehen – nicht als Ausnahme, sondern als Teil des Plans.
- Mit anderen teilen: Gefühle von Frust oder Scham verlieren an Macht, wenn man sie mit vertrauten Menschen teilt – z. B. in ADHS-Communities (wie z.B. über das ADHS-Deutschlandnetzwerk) oder in Gesprächen mit Freunden.
- Erholung legitimieren: Sich aktiv sagen: „Ich darf mich ausruhen, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen.“
Zusammenspiel mit Strukturkomponenten
Selbstmitgefühl ist kein Gegensatz zu Struktur, sondern ihr emotionaler Ausgleich. Während Zeitinseln, Anker und Tools den Tag organisieren, verhindert Selbstmitgefühl, dass Rückschläge als persönliches Versagen interpretiert werden. Es erlaubt es, den Plan anzupassen statt abzubrechen – und damit langfristig dranzubleiben.
Gerade bei ADHS ist das „Scheitern am eigenen Anspruch“ ein häufiges Muster (Knouse & Safren, 2010). Wer aber mit sich selbst sanft und wohlwollend umgeht, stärkt die Resilienz – also die Fähigkeit, nach Misserfolgen wieder aufzustehen und es neu zu versuchen.
Fazit
Die „plötzliche“ Ferienzeit bringt für viele Menschen mit ADHS eine besondere Herausforderung mit sich: auf einmal fehlen die äußeren Strukturen, die im Alltag für Orientierung sorgen, Kollegen, die einem Rückhalt geben, sind im Urlaub, es gibt nicht genug Auslastung oder man ist selbst einfach sehr erschöpft, aber bemerkt es nicht bzw. will es sich nicht eingestehen. Aber genau in dieser scheinbaren Freiheit liegt auch eine Chance, indem individuelle, flexible Routinen zu entwickeln, die auf die eigenen Bedürfnisse und Funktionsweisen des Gehirns abgestimmt sind.
Zentrale Bausteine dafür sind:
- Tagesanker und Mikro-Routinen, die Orientierung geben, ohne zu überfordern
- Kleinschrittige Zielsetzungen, die motivieren, statt zu blockieren
- Zeitinseln für Bewegung, Fokus und Pausen, die sich modular in den Tag integrieren lassen
- Soziale und digitale Anker, die Verbindlichkeit und Unterstützung schaffen – auch bei geringer Eigenmotivation
- Und nicht zuletzt: Selbstmitgefühl, das hilft, Rückschläge zu verkraften und neue Anläufe zu wagen, ohne sich selbst abzuwerten
Die Forschung zeigt klar: Struktur und Selbstfürsorge schließen sich nicht aus – sie bedingen einander (Neff & Germer, 2013; Antshel & Barkley, 2020). Wer sich erlaubt, auch unperfekte Tage als Teil des Prozesses zu betrachten, stärkt langfristig seine Selbstwirksamkeit – eine Ressource, die bei ADHS oft untergraben ist, aber trainierbar bleibt (Sibley et al., 2022). Aus eigener Erfahrung heraus kenne ich es zu gut, wenn man selbst sein größter Kritiker ist. Jedwedes Lob wird als falsch abgetan, die eigene Leistung nie genug und es gibt noch einen höheren Standard, den man hätte vermeintlich erreichen können. Dass man sich selbst hierfür aber in einem fortlaufenden Prozess befindet, der vor allem durch die Anerkennung von Außenstehenden unterstützt wird, sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Am Ende ist es wie bei einem Marathon, bei dem man nicht stetig an die zu laufendend 42km denkt, aber Schritt für Schritt einfach weiterläuft und sich selbst auf den Moment konzentriert, bis man schließlich die Ziellinie überquert. Die Vorbereitung dafür wird nicht minder, wie das Rennen auch, von Rückschlägen geprägt sein, aber wenn man sich selbst weiter an diesen Plan zu hält und fortlaufend dran arbeitet:
Ferien dürfen leicht sein – aber nicht haltlos.
Struktur darf helfen – ohne zu kontrollieren.
Und Selbstmitgefühl darf heilen – ohne zur Ausrede zu werden.
In diesem Sinne: Mach’s kleinschrittig. Mach’s mit Herz. Und vor allem – mach’s auf deine Weise & in deinem Tempo
Quellen
- Antshel, K. M., & Barkley, R. A. (2020). Executive functioning and ADHD: Impairments in multiple executive processes. In R. A. Barkley (Ed.), Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (4th ed., pp. 297–314). The Guilford Press
- Barkley, R. A. (2011). Executive Functions: What They Are, How They Work, and Why They Evolved. Guilford Press
- Barkley, R. A., Murphy, K. R., & Bush, T. (2001). Time perception and reproduction in young adults with ADHD. Neuropsychology, 15(3), 351–360. https://doi.org/10.1037/0894-4105.15.3.351
- Becker, S. P., Sidol, C. A., Van Dyk, T., Epstein, J. N., & Beebe, D. W. (2018). Predicting academic and social impairment in adolescents with ADHD: The role of sleep functioning. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59(7), 745–754
- Brown, T. E. (2006). Attention Deficit Disorder: The Unfocused Mind in Children and Adults. Yale University Press
- Gapin, J. I., & Etnier, J. L. (2010). The relationship between physical activity and executive function performance in children with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Sport and Exercise Psychology, 32(6), 753–763
- Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006
- Knouse, L. E., & Safren, S. A. (2010). Current status of cognitive behavioral therapy for adult attention-deficit hyperactivity disorder. The Psychiatric Clinics of North America, 33(3), 497–509
- Knouse, L. E., Mitchell, J. T., & Anastopoulos, A. D. (2017). Treatment of adults with ADHD. In A. A. Barkley (Ed.), Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th ed., pp. 705–738). Guilford Press.
- Knouse, L. E., Zvorsky, I., & Safren, S. A. (2013). Emotion regulation difficulties in adults with ADHD: The role of adaptive and maladaptive strategies. Behavior Modification, 37(5), 665–691
- Kofler, M. J., Irwin, L. N., Soto, E. F., Groves, N. B., Harmon, S. L., & Sarver, D. E. (2018). Executive functioning heterogeneity in pediatric ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 46(8), 1457–1472. https://doi.org/10.1007/s10802-017-0369-8
- Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250. https://doi.org/10.1080/15298860309027
- Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program. Journal of Clinical Psychology, 69(1), 28–44. https://doi.org/10.1002/jclp.21923
- Owens, J. S., Evans, S. W., & Bunford, N. (2020). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 49(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/15374416.2019.1696143
- Pontifex, M. B., Saliba, B. J., Raine, L. B., Picchietti, D. L., & Hillman, C. H. (2013). Exercise improves neurocognitive function in children with ADHD. The Journal of Pediatrics, 162(3), 543–551
- Ramsay, J. R., & Rostain, A. L. (2016). The adult ADHD toolkit: Using CBT to facilitate coping inside and out. Routledge
- Robin, A. L., & Sprich, S. (2009). Cognitive-behavioral therapy for adult ADHD. Psychiatric Clinics, 32(3), 525–538
- Safren, S. A., Sprich, S., Chulvick, S., & Otto, M. W. (2005). Psychosocial treatments for adults with ADHD. The Psychiatric Clinics of North America, 28(2), 301–319
- Shaw, P., Stringaris, A., Nigg, J., & Leibenluft, E. (2014). Emotion dysregulation in attention-deficit/hyperactivity disorder. The American Journal of Psychiatry, 171(3), 276–293
- Sibley, M. H., Graziano, P. A., Kuriyan, A. B., Coxe, S., Pelham, W. E., & Rodriguez, L. (2016). Parent–teen behavior therapy + motivational interviewing for adolescents with ADHD. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(8), 699–712
- Sibley, M. H., Kuriyan, A. B., & Evans, S. W. (2022). The science of motivation and self-regulation in ADHD. In Handbook of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67989-1_23
- Sonuga-Barke, E. J. S., & Castellanos, F. X. (2007). Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions: A neurobiological hypothesis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 31(7), 977–986
- Tamm, L., Epstein, J. N., Peugh, J. L., Nakonezny, P. A., & Hughes, C. W. (2012). Preliminary data suggesting the efficacy of attention training for school-aged children with ADHD. Developmental Cognitive Neuroscience, 2(Suppl 1), S146–S154
- Volkow, N. D., Wang, G. J., Kollins, S. H., Wigal, T. L., Newcorn, J. H., Telang, F., … & Swanson, J. M. (2009). Evaluating dopamine reward pathway in ADHD: Clinical implications. JAMA, 302(10), 1084–1091
- Wehmeier, P. M., Schacht, A., & Barkley, R. A. (2009). Social and emotional impairment in children and adolescents with ADHD and the impact on quality of life. Journal of Adolescent Health, 46(3), 209–217

Schreibe einen Kommentar